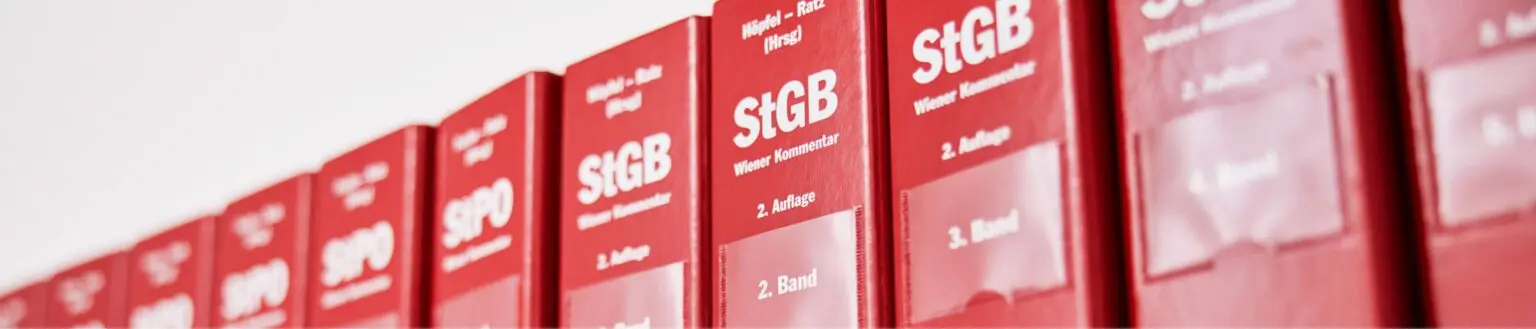Allgemeines
Unter dem Begriff „Rechtsmittel“ ist eine formalisierte Anfechtung einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung zu verstehen, die stets an eine bestimmte Frist gebunden ist. Rechtsmittel gibt es in allen Rechtsgebieten. Sie sind ein wichtiges Schutzinstrument, um beispielsweise Verfahrensfehler und fehlerhafte Urteile zu bekämpfen.
Im Strafverfahren steht zumeist viel auf dem Spiel, da die Auswirkungen einer strafgerichtlichen Verurteilung existenzbedrohend sein können. Ein auf das Strafrecht spezialisierter Rechtsanwalt klärt Sie über die konkreten Möglichkeiten in Ihrem individuellen Verfahren auf und unterstützt Sie gegebenenfalls bei der korrekten Einbringung des Rechtsmittels.
Rechtsmittel gegen Urteile
Urteile im Strafverfahren werden nach einer öffentlichen Hauptverhandlung mündlich durch den Richter verkündet. Im Jahr 2022 wurden in Österreich über 30.000 Urteile gefällt, von denen etwa 70% zu Verurteilungen führten und in ca 30% in einem Freispruch resultierten. Die meisten Verfahren enden somit mit einem Schuldspruch, der – wie dargestellt – oft schwerwiegende Folgen für den Angeklagten hat. Gegen jeden erstinstanzlichen Schuldspruch kann daher ein Rechtsmittel erhoben werden.
Nach Verkündigung des Urteils in der Hauptverhandlung bestehen drei Optionen:
- Der Angeklagte nimmt das Urteil nach der Verkündung an und verzichtet auf sämtliche Rechtsmittel. Falls die Staatsanwaltschaft keine Rechtsmittel erhebt, wird das Urteil rechtskräftig und die verhängte Strafe kann vollzogen werden.
- Der Angeklagte meldet (selbst oder über seinen Verteidiger) ein Rechtsmittel an. Nach der Zustellung des schriftlich ausgefertigten Urteils beginnt eine vierwöchige Frist zur Einbringung eines Rechtsmittels zu laufen. Das Rechtsmittel hat aufschiebende Wirkung und das Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig – das übergeordnete Gericht hat nun zu entscheiden.
- Der Angeklagte nimmt sich drei Tage Bedenkzeit, ob er ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung einbringen möchte oder nicht. Entscheidet er sich dafür, ist das Rechtsmittel binnen 3 Tagen anzumelden. Mit Zustellung des schriftlichen Urteils beginnt die vierwöchige Rechtsmittelfrist zu laufen. Nach Einbringung des Rechtsmittels entscheidet auch in diesem Fall das übergeordnete Rechtsmittelgericht.
Berufung
Urteile eines Richters am Bezirksgericht oder eines Einzelrichters am Landesgericht können durch Berufung wegen
- Nichtigkeit (Sind im Verfahren formelle oder inhaltliche Fehler aufgetreten?)
- Schuld (Ist der Angeklagte schuldig?)
- Strafe (Ist die Höhe der Strafe angemessen?)
- Ausspruch über privatrechtliche Ansprüche (Erfolgte der Privatbeteiligtenzuspruch und dessen Höhe zu Recht?)
bekämpft werden.
Erhebt man alle genannten Berufungsgründe, spricht man von einer „vollen Berufung“.
Berufung wegen Nichtigkeit und Nichtigkeitsbeschwerde
Nichtigkeitsgründe in einem bezirksgerichtlichen Urteil oder in einem Urteil des Landesgerichts als Einzelrichter können mit Berufung wegen Nichtigkeit bekämpft werden.
Im Falle einer erstinstanzlichen Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder Geschworenengericht können Nichtigkeitsgründe im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde bekämpft werden.
Mit der Nichtigkeitsbeschwerde bzw. Nichtigkeitsberufung werden also Nichtigkeitsgründe, d.h. formelle oder materielle Fehler, die im Verfahren aufgetreten sind, geltend gemacht.
Nichtigkeitsgründe sind beispielsweise:
- Ein Protokoll über eine nichtige Beweisaufnahme im Ermittlungsverfahren, dessen Verwertung nicht erlaubt war, wurde in der Hauptverhandlung trotz Widerspruchs verlesen (§ 281 Abs 1 Z 2 StPO).
- In der Hauptverhandlung wurde über einen Antrag nicht entschieden oder dieser wurde mittels Beschlusses abgewiesen. Dieser Nichtigkeitsgrund ist jedoch nur dann erfüllt, wenn durch diese Abweisung die Gesetze und Grundsätze eines fairen Verfahrens (Art 6 der Europäische Menschenrechtskonvention) verletzt wurden (§ 281 Abs 1 Z 4 StPO).
- Der vom Gericht festgestellte Sachverhalt stellt keine strafbare Handlung dar. Dieser Nichtigkeitsgrund ist insbesondere dann gegeben, wenn dem Urteil keine ausreichenden Feststellungen für die Annahme einer strafbaren Handlung enthält (§ 281 Abs 1 Z 9 lit a StPO).
Abgesehen davon bestehen noch einige weitere Nichtigkeitsgründe (§ 281 Abs 1 StPO), deren Vorliegen nach Erhalt des schriftlichen Urteils sorgfältig durch einen Verteidiger geprüft werden sollte.
Berufung wegen Schuld
Die Berufung wegen Schuld bekämpft die Beweiswürdigung des Gerichts. In diesem Zusammenhang werden Bedenken gegen die Richtigkeit der Feststellungen des Erstgerichts, die zur Verurteilung geführt haben, dargelegt. Bei der Schuldberufung gibt ist es kein Neuerungsverbot, wodurch neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden können. Im Berufungsverfahren können auch neue Beweisanträge (§ 55 StPO) gestellt werden. Im Gegensatz zu Urteilen, die von Einzelrichtern am Landesgericht verhängt werden, sind gegen Urteile von Geschworenen- oder Schöffengerichten als Rechtsmittel lediglich die Nichtigkeitsbeschwerde sowie die Strafberufung und Berufung wegen privatrechtlicher Ansprüche zulässig (§§ 280, 344 StPO).
Berufung wegen Ausspruchs über die Strafe
Mit der Strafberufung (Berufung wegen Ausspruchs über die Strafe) kann die Höhe der verhängten Strafe bekämpft werden. Eine Strafberufung richtet sich demnach gegen die richterliche Ermessensentscheidung bei der Verhängung der konkreten Strafe. In der Strafberufung kann auch die unrichtige Abwägung der Erschwerungs- und Milderungsgründe gerügt werden.
In der Strafberufung können einerseits die Dauer der verhängten Freiheitsstrafe und andererseits die Höhe und Anzahl der verhängten Geldstrafen in Frage gestellt werden. Darüber hinaus können Argumente vorgebracht werden, warum im vorliegenden Fall eine bedingte Strafnachsicht angebracht erscheint.
Systemkontrolle außerhalb des subjektiven Rechtsschutzes: Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes (§ 23 StPO)
Die „Wahrungsbeschwerde (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes nach § 23 StPO) nimmt eine Sonderstellung innerhalb des verfahrensrechtlichen Instrumentariums der österreichischen Strafprozessordnung ein. Sie steht allein der Generalprokuratur zu. Diese kann eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes von Amts wegen oder im Auftrag der Bundesministerin für Justiz erheben. Jede Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, Fälle, in denen sie eine Beschwerde für erforderlich hält, von Amts wegen der zuständigen Oberstaatsanwaltschaft vorzulegen. Diese hat dann zu entscheiden, ob der Fall an die Generalprokuratur übermittelt wird. Im Übrigen kann jeder eine solche Beschwerde anregen (§ 23 Abs 2 StPO). Somit haben beispielsweise auch Angeklagte das Recht, eine Wahrungsbeschwerde anzuregen.
Die Generalprokuratur ist die höchste staatsanwaltschaftliche Behörde der Republik, die außerhalb der eigentlichen Strafverfolgung fungiert. Dabei tritt sie nicht als Ermittlerin oder Anklägerin auf, sondern als Rechtswahrerin, die eine gesetzeskonforme Strafrechtspflege sicherstellen soll.
Die Generalprokurator kann gegen Urteile der Strafgerichte, die auf einer Verletzung oder unrichtigen Anwendung des Gesetzes beruhen, sowie gegen jeden gesetzwidrigen Beschluss oder Vorgang eines Strafgerichts, über den sie Kenntnis erlangt, vorgehen und durch eine Wahrungsbeschwerde beim Obersten Gerichtshof eine Feststellung der Gesetzeswidrigkeit verlangen (§§ 23 Abs 1, 34 Abs 1 Z 2 StPO).
Die Besonderheit der Wahrungsbeschwerde liegt darin, dass sie auch dann noch erhoben werden kann, wenn die Rechtskraft der Entscheidung schon eingetreten ist und wenn die berechtigten Personen in der gesetzlichen Frist nicht von einem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf Gebrauch gemacht haben (§ 23 Abs 1 StPO).
Empfindet der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes als zutreffend, so hat er zu erkennen, dass in der konkreten Strafsache das Gesetz verletzt worden ist. Dieser Ausspruch ist in der Regel ohne Wirkung auf den Angeklagten. Ist jedoch der Angeklagte durch ein solches nichtiges Urteil zu einer Strafe verurteilt worden, so kann der Oberste Gerichtshof entweder den Angeklagten freisprechen, einen milderen Strafsatz anwenden oder eine Erneuerung des Verfahrens anordnen (§ 292 StPO).
Ziel der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes ist, eine zuverlässig funktionierende und rechtskonforme Strafrechtspflege zu gewährleisten.
Rechtsmittelgerichte
Fällt ein Bezirksgericht in erster Instanz ein Urteil, entscheidet über die Berufung gegen dieses Urteil in zweiter Instanz das übergeordnete Landesgericht als Dreirichter-Senat (§ 31 Abs 6 Z 1 StPO). Im Falle einer erstinstanzlichen Zuständigkeit eines Einzelrichters an einem Landesgericht begründet eine Berufung eine zweitinstanzliche Zuständigkeit des übergeordneten Oberlandesgerichts ebenfalls als Drei-Richter-Senat (§ 33 Abs 1 Z 1 StPO).
Ist das Landesgericht als Schöffengericht oder als Geschworenengericht in erster Instanz zuständig, so ist bei einer erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde der Oberste Gerichtshof zur Entscheidung zuständig (§ 34 Abs 1 Z 1 StPO). Dieser entscheidet in einem Senat aus fünf Richtern. Wird hingegen gegen ein Urteil eines Landesgerichts als Schöffen- oder Geschworenengericht nur eine Berufung wegen der Strafhöhe erhoben, so entscheidet das übergeordnete Oberlandesgericht (§ 33 Abs 1 Z 2 StPO).
Spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren
Bei der Erstellung und Einbringung eines Rechtsmittels ist es ratsam, einen auf das Strafrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Dieser kann die Erfolgschancen des jeweiligen Rechtsmittels realistisch einschätzen und weiß, worauf es beim Verfassen eines solchen Schriftsatzes ankommt und worauf die Rechtsmittelinstanzen besonderen Wert legen. Darüber hinaus kann ein Rechtsanwalt Klarheit darüber schaffen, ob ein Rechtsmittel im konkreten Fall überhaupt (noch) möglich beziehungsweise sinnvoll ist.
Teilweise muss ein Rechtsmittel sogar von einem Verteidiger eingebracht werden. Insbesondere die Nichtigkeitsbeschwerde an den Obersten Gerichtshof muss von einem Strafverteidiger eingebracht werden. Aber auch abgesehen davon ist es zumeist ratsam, die Formulierung eines Rechtsmittels in die Hände eines Spezialisten zu legen.