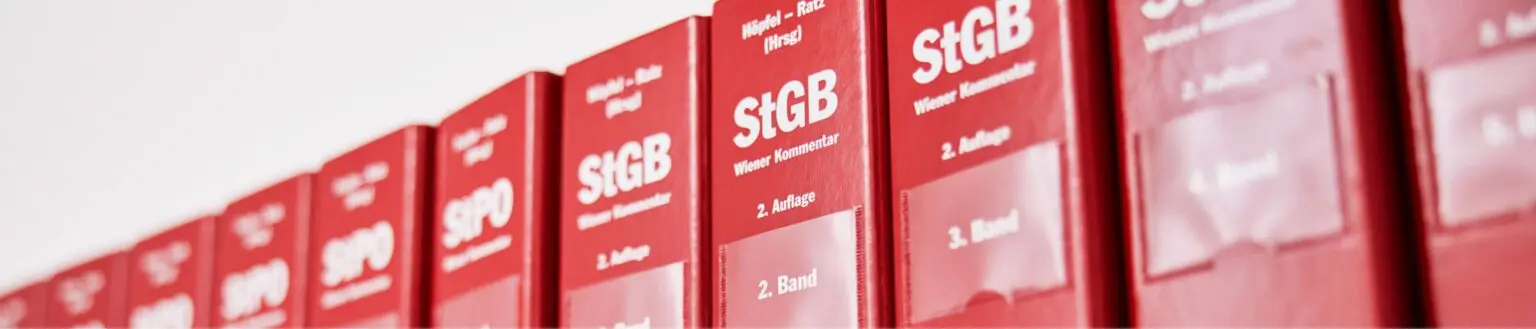Verteidigerkostenbeitrag – Erhöhung der Ansprüche
Eine wesentliche Reform des Strafprozessrechts trat bereits im Sommer 2024 mit der Anpassung der Verteidigerkostenbeiträge in Kraft (§ 393a StPO und § 196a StPO). Beschuldigte haben nun auch bei der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens Anspruch auf einen Beitrag zu den Kosten ihrer Verteidigung (kein vollständiger Ersatz). Bislang war dieser Beitrag nur bei Freisprüchen im Hauptverfahren möglich. Die neuen Pauschalbeträge wurden dabei deutlich angehoben: Im Hauptverfahren sind nun – bei (Geschworenen-)Verfahren von extremem Umfang – bis zu EUR 60.000 möglich, bei der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens – ebenfalls bei Verfahren von extremem Umfang – maximal EUR 12.000. Die in der Praxis durchschnittlich zugesprochenen Werte sind wesentlich niedriger.
Die Anhebung und Ausweitung des Verteidigerkostenbeitrags wird von Verteidigern begrüßt, da er die finanzielle Belastung von Beschuldigten reduziert. Von einer angemessenen Entschädigung insbesondere der Betroffenen großer Wirtschaftsstrafverfahren, deren Kosten ein Vielfaches der Höchstbeträge ausmachen, ist man jedoch noch weit entfernt.
Stärkung der Rechte zu Beginn des Ermittlungsverfahrens
Das Ermittlungsverfahren beginnt, sobald die Strafverfolgungsbehörden wegen eines strafrechtlichen Anfangsverdachts ermitteln (§ 1 Abs 2 StPO). Bisher konnte die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines Strafverfahrens absehen, wenn sie keinen Anfangsverdacht bejahte (§ 35c StAG). Dagegen war kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Darüber hinaus wurde der Angezeigte nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass er angezeigt wurde.
Mit der Implementierung von § 35c StAG in die Strafprozessordnung ist es dem Gesetzgeber gelungen, sowohl die Rechte der Angezeigten als auch die der Opfer zu stärken. Anstelle des § 35c StAG wurde § 197a StPO geschaffen, der in seinen Grundzügen § 35c StAG gleicht. Die Staatsanwaltschaft ist weiterhin berechtigt, von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, sofern sie keinen Anfangsverdacht bejaht. Legt die Staatsanwaltschaft eine Anzeige zurück, hat sie sämtliche Personen zu verständigen, die auch im Rahmen einer Einstellung eines Ermittlungsverfahrens zu verständigen wären (insbesondere den Angezeigten und das Opfer). Zudem haben Anzeiger, die über eine Opferstellung verfügen, das Recht, einen Antrag auf Verfolgung zu stellen, über den das zuständige Landesgericht zu entscheiden hat (§ 197c StPO).
Eingeführt wurde auch eine Art „Sperrwirkung“, die vor allem Angezeigten zugutekommt. Bislang galt, dass die Staatsanwaltschaft an ihrer Entscheidung vom Absehen der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht gebunden war, sodass sie bei einer erneuten Anzeige desselben Sachverhalts uneingeschränkt ermitteln konnte. Dieser Vorgehensweise hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben: Nunmehr ist ausdrücklich geregelt, dass eine neuerliche Anzeige nach erfolgter Zurücklegung der Staatsanwaltschaft nur dann verfolgt werden kann, wenn die Tat noch nicht verjährt ist und
- das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde oder
- neue Tatsachen oder Beweise beigebracht werden, die für sich allein oder im Zusammenhalt mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, einen Anfangsverdacht zu begründen (§ 197a Abs 2 StPO).
Abschaffung der Vorfeldermittlungen
Eine weitere zentrale Neuerung des Strafprozessrechts sieht nunmehr eine raschere Einleitung des Ermittlungsverfahrens vor. Die Abschaffung von „Vorfeldermittlungen“ (§ 91 Abs 2 letzter Satz StPO) als Schwelle zum Beginn des Ermittlungsverfahrens soll bestehende Defizite im Rechtsschutz während der oft intransparenten Phase der „Vorfeldermittlungen“ beheben. Bislang konnten Strafverfolgungsbehörden durchaus weitreichende Prüfungen zu der Frage durchführen, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Mittlerweile gilt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen angezeigte Personen bereits dann eingeleitet wird, sobald die Staatsanwaltschaft oder Kriminalpolizei aufgrund einer Anzeige oder eines Verdachts tätig wird.
Hiervon ausgenommen sind lediglich Erkundigungen zur Klärung, ob bestimmte Anhaltspunkte auf einen Sachverhalt hinweisen, der einem gesetzlichen Tatbestand entspricht (§ 91 Abs 3 StPO). Dadurch wird der Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft in eng definierten Fällen (meist unmittelbar nach einem Vorfall vor Ort) weiterhin ermöglicht, Auskünfte einzuholen oder Mitteilungen von Personen entgegenzunehmen, um festzustellen, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden, die sich gezielt gegen eine Person richten, sollen jedoch in jedem Fall die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge haben.
Dies soll die Rechtssicherheit erhöhen, da Unklarheiten darüber, ob ein Handeln der Strafverfolgungsbehörden bereits den Beginn eines Ermittlungsverfahrens auslöst, weitgehend beseitigt werden. Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage werden Personen bei Bejahung eines Anfangsverdachts und nachfolgendem Tätigwerden der Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft zwar früher als Verdächtige eingestuft, jedoch werden ihre Rechte gestärkt: Ab jedem Tätigwerden einer Strafverfolgungsbehörde sollen ihnen künftig sämtliche Verfahrensgarantien und Beschuldigtenrechte zustehen, wie das Recht auf Akteneinsicht, beispielsweise um die Strafanzeige oder Sachverhaltsdarstellung möglichst früh zu prüfen.
Veröffentlichung von Entscheidungen der Oberlandesgerichte
Mit der Neuregelung des § 48a GOG wird ein lange bestehendes Defizit in Sachen Transparenz beseitigt. Alle rechtskräftigen Entscheidungen der Oberlandesgerichte müssen – mit gewissen Ausnahmen – künftig veröffentlicht werden, um die Waffengleichheit zwischen Strafverfolgung und Verteidigung zu gewährleisten und dem Recht auf ein faires Verfahren (Art 6 EMRK) zu entsprechen. Bisher hatten nur Staatsanwaltschaften und Gerichte justizinternen Zugang zu diesen Entscheidungen, während Verteidiger und Angeklagte durch die mangelnde Einsichtsmöglichkeit in die oftmals nicht veröffentlichen Entscheidungen der Oberlandesgerichte benachteiligt wurden. Der Persönlichkeitsschutz ist dabei aber stets zu berücksichtigen, weshalb jede Entscheidung vor der Veröffentlichung pseudonymisiert werden muss.
Neuregelung der Beschlagnahme von Datenträgern und Daten
Eine der bedeutendsten Änderungen des Strafprozessrechts im Jahr 2025 betrifft die Beschlagnahme von Datenträgern und Daten und beruht auf einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH). Mit Erkenntnis vom 14.12.2023 (G 352/2021) hat der VfGH die bisherigen Bestimmungen zur Handy-Sicherstellung aufgehoben. Gleichzeitig hat er ausgesprochen, dass die Sicherstellung analoger Gegenstände nicht mit jener von Mobiltelefonen gleichzusetzen ist. Letztere können über Jahrzehnte angefallene Datenbestände speichern, die weitreichende Rückschlüsse auf das Privatleben der betroffenen Person ermöglichen.
Mit der neuen Regelung wird nun klar zwischen der Sicherstellung von analogen Gegenständen und der Beschlagnahme von Daten unterschieden. Datenträger dürfen künftig nur noch aufgrund einer gerichtlich bewilligten Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden, in der die zu beschlagnahmenden Datenkategorien und Zeiträume vorab definiert wurden. Dadurch möchte der Gesetzgeber die Möglichkeit von „fishing expeditions“ (also die unspezifische Suche nach belastenden Informationen) durch Strafverfolgungsbehörden verhindern. Die konkrete Durchführung der Beschlagnahme erfolgt in den meisten Fällen nach wie vor im Rahmen einer Hausdurchsuchung.
Die darauffolgende Auswertung beschlagnahmter Daten erfolgt nun in mehreren Schritten: Zuerst wird eine vollständige Originalsicherung erstellt, die unverändert bleibt, während die Aufbereitung der Daten anhand einer Arbeitskopie erfolgt. Im Rahmen der Auswertung haben sich die Strafverfolgungsbehörden auf den in der gerichtlichen Bewilligung gesteckten Rahmen zu halten und können entsprechende Suchparameter festlegen, die im Akt zu speichern sind. Diese neue Struktur soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Datenverarbeitung erhöhen.
Neben eines Einspruches wegen Rechtsverletzung (§ 106 Abs 1 StPO) oder die Erhebung einer Beschwerde (§ 87 Abs 1 StPO) sieht § 115l StPO nunmehr auch umfassende Aufsichts- und Kontrollrechte des Rechtsschutzbeauftragten der Justiz zur Sicherung der Betroffenenrechte vor. Dieser ist nach erfolgter gerichtlicher Bewilligung der Anordnung der Staatsanwaltschaft zu informieren. Er kann den gesamten Auswertevorgang überwachen und darf sich schlussendlich nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens von der Vernichtung der Daten überzeugen.
Vom Gesetzgeber war beabsichtigt, die Rechte von Betroffenen zu stärken. Von einer gänzlich gelungenen Reform kann dennoch nicht die Rede sein: Während die Transparenz des Auswertungsvorganges positiv hervorzuheben ist, wird die Sicherung des gesamten Datenbestandes in Form der Herstellung einer Originalsicherung aus grundrechtlicher Sicht bemängelt. Zudem werden den Betroffenen die Datenträger oft wochen- oder monatelang entzogen, obwohl eine auf Datenkategorien und Zeiträume beschränkte Datenspiegelung („Sicherung“) bei der Durchführung der Beschlagnahme sogar gesetzlich vorgesehen ist (§ 115f Abs 6 StPO), aber mangels Ressourcen oftmals nicht angewendet wird. Daher wird die Hardware oftmals entzogen, was zu erheblichen Nachteilen der Betroffenen führt.
Auch die immer noch bestehende Möglichkeit, sogenannte Zufallsfunde zu verwenden, wird häufig kritisiert. Zufallsfunde sind Hinweise, die auf die Begehung einer anderen strafbaren Handlung, die nicht Anlass zur Beschlagnahme gegeben hat, hindeuten. Im Rahmen einer erneuten gerichtlich bewilligten Anordnung kann wiederholt auf den gesamten Datenbestand zugegriffen werden.
Vermögenswerte können mittlerweile auch transferiert werden
Daneben gab es noch weitere relevante Änderungen in der StPO, die bislang weniger (mediale) Beachtung fanden. So wurde an verschiedensten Stellen, in denen zunächst nur von Gegenständen die Rede war, der Begriff „sonstige Vermögenswerte“ ergänzt. Dies war deshalb geboten, um den Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, das Vermögen von Personen auf deren Konten nicht nur zu sperren, sondern dieses auch transferieren zu können. Profitieren können dadurch vor allem auch Privatbeteiligte, die ihren durch die Tat erlittenen Schaden im Strafverfahren geltend machen können.
Recht auf Verfahrenstrennung
Normiert wurde nunmehr auch ein subjektives Recht von Beschuldigten auf Verfahrenstrennung, das mittels Einspruchs wegen Rechtsverletzung (§ 106 Abs 1 StPO) durchsetzbar ist. In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber auch eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Verfahrenstrennung einzelner Straftaten oder gegen einzelne Angeklagte auch im Hauptverfahren geschaffen (§ 37 Abs 4 StPO). Das Gericht kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft, eines Beschuldigten oder von Amts wegen, eine getrennte Führung des Verfahrens unter den Voraussetzungen des § 27 StPO anordnen. Diese Vorgehensweise kommt vor allem dann in Betracht, um Verzögerungen zu vermeiden (Beschleunigungsgebot gemäß § 9 StPO), schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen eines Angeklagten zu wahren oder die Haft des Angeklagten zu verkürzen (§ 27 StPO).
Verkürzung der Höchstdauer und Einstellung des Ermittlungsverfahrens
Ein mehr oder weniger zahnloser Versuch der Reform betrifft die Beschleunigung von Ermittlungsverfahren. Der Gesetzgeber unternahm den Versuch, die bisherigen Bestimmungen über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens (§ 108 StPO) mit den Vorschriften über die Höchstdauer des Verfahrens (§ 108a StPO) zusammenzulegen, obwohl diese Bestimmungen nur wenige Gemeinsamkeiten aufweisen. Die maximale Verfahrensdauer wurde dabei von drei auf zwei Jahre reduziert. Zeitgleich wurde die amtswegige Befassung des Gerichts nach erstmaligem Überschreiten der Höchstfrist abgeschafft. Es ist aber davon auszugehen, dass die Gerichte in der Praxis weiterhin dazu neigen werden, Ermittlungsfristen zu verlängern, insbesondere in umfangreicheren Fällen.
Begrüßenswert ist hingegen die Klarstellung des Gesetzgebers in § 108 StPO, wonach ein Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens nunmehr ausdrücklich auch für Teileinstellungen möglich ist, was vor allem in umfangreichen Verfahren mit zahlreichen Fakten eine praxisrelevante Klarstellung darstellt. Darüber hinaus können Beschuldigte nun jederzeit einen Antrag auf Verfahrenseinstellung einbringen, ohne an starre Fristen gebunden zu sein.
Neu ist außerdem, dass Gerichte bei einem solchen Antrag, der auch die Behauptung der Verletzung des Beschleunigungsgebots (§ 9 StPO) enthält, konkrete verfahrensbeschleunigende Maßnahmen anordnen können. Diese Maßnahmen sollen die Verfahren effektiver machen und das Beschleunigungsgebot stärker durchsetzen.