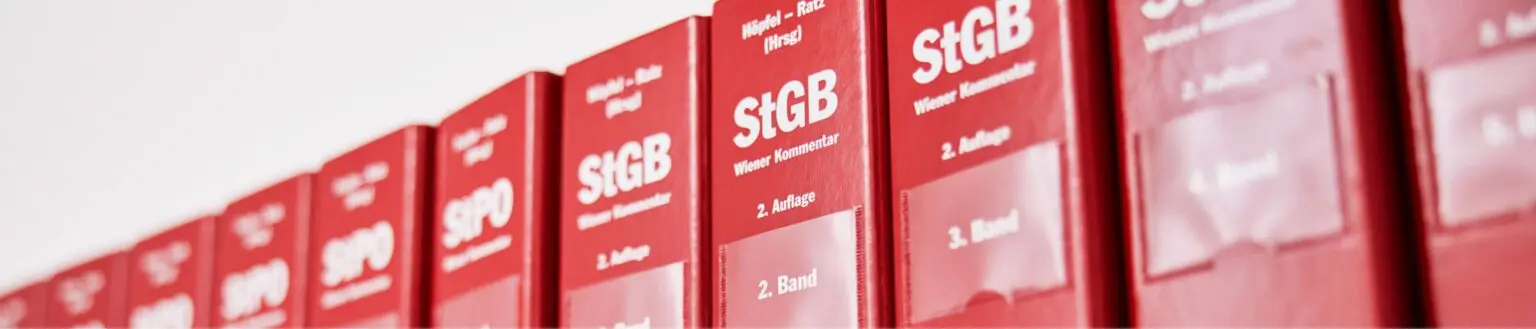Überblick und geschütztes Rechtsgut
Nach § 95 StGB ist zu bestrafen, wer es bei einem Unglücksfall oder bei einer Gemeingefahr unterlässt, die zur Rettung eines Menschen aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung offensichtlich erforderliche und zumutbare Hilfe zu leisten.
§ 95 StGB dient dem Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit. Anders als das Delikt des Imstichlassen eines Verletzten (§ 94 StGB) knüpft die Norm nicht an eine durch den Täter selbst verursachte Körperverletzung an, sondern verpflichtet allgemein jede Person, in Notfällen Hilfe zu leisten. Diese allgemeine Solidaritätspflicht wird strafrechtlich abgesichert, wobei schon das bloße Untätigbleiben tatbestandsmäßig ist und eine Strafbarkeit begründen kann.
Tatbestandsvoraussetzungen
Objektive Tatbestandsmerkmale
Ein Unglücksfall liegt vor, wenn ein plötzliches Ereignis einen erheblichen Schaden verursacht oder unmittelbar befürchten lässt. Dazu zählen schwere Unfälle, akute Krankheitszustände oder andere lebensbedrohliche Situationen. Aus § 95 StGB lässt sich jedoch keine Verpflichtung ableiten, bei einem zum Sterben entschlossenen, todkranken Menschen lebensverlängernde medizinische Maßnahmen zu ergreifen. Eine derartige Konstellation ist nicht als „Unglücksfall“ im Sinne der Bestimmung zu qualifizieren und fällt daher nicht in deren Anwendungsbereich.
Eine Gemeingefahr (§ 176 StGB) ist gegeben, wenn eine Gefahr für eine größere Zahl von Menschen oder für bedeutende Sachwerte im großen Ausmaß besteht. Darunter fallen typischerweise Ereignisse wie Naturkatastrophen, Brände oder Explosionen. Hinsichtlich der Zahl der betroffenen Personen wird ein Richtwert von etwa zehn Menschen herangezogen. Erforderlich ist das Bestehen einer konkreten Gefahr des Todes oder einer erheblichen Körperverletzung bzw. Gesundheitsschädigung. Eine solche konkrete Gefahr liegt vor, wenn das drohende Geschehen nach den Umständen des Einzelfalls als wahrscheinlich und in zeitlicher Hinsicht als unmittelbar bevorstehend einzustufen ist.
Damit die allgemeine Hilfspflicht ausgelöst wird, muss eine Verletzung das Ausmaß einer beträchtlichen Verletzung erreichen. Bloße Bagatellverletzungen – etwa leichte Schnitt- oder Schürfwunden – genügen für die Begründung einer Pflicht nach § 95 StGB nicht.
Die Hilfe muss zudem offensichtlich erforderlich sein. Unter „offensichtlich“ ist zu verstehen, dass die Notwendigkeit der Hilfeleistung augenscheinlich erkennbar ist. Erforderlich sind sämtliche Maßnahmen, die geeignet sind, die Lage des Betroffenen zu verbessern oder die bestehende Gefahr zu verringern. Da der Tatbestand des § 95 StGB auch auf die Gefahrenbeseitigung abstellt, ist der Kreis möglicher Hilfehandlungen weiter gefasst als bei § 94 StGB. So können etwa das Abschalten von Gefahrenquellen oder die Abgabe von Warnzeichen ebenfalls als erforderliche Hilfeleistungen im Sinne der Norm anzusehen sein.
Die Pflicht zur Hilfeleistung trifft jedermann und endet grundsätzlich erst mit dem tatsächlichen Eingreifen sachkundiger Dritter (z. B. Ärzte, Sanitäter oder Pflegepersonal). Ein bloßes Absetzen eines Notrufs genügt daher in der Regel nicht, solange der Helfer nach seinen persönlichen Fähigkeiten noch selbst einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten kann. Dabei ist naturgemäß von medizinisch geschulten Personen – insbesondere Ärzten – ein höheres Maß an Hilfeleistung zu erwarten als von Laien.
Ein weiteres objektives Tatbestandsmerkmal ist, dass die Hilfeleistung tatsächlich möglich gewesen sein muss. Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen, wenn eine räumliche und zeitliche Nähe zum Unglücksfall bzw zur Gemeingefahr besteht. Wer hingegen tatsächlich an einer Hilfeleistung gehindert ist, macht sich grundsätzlich nicht strafbar.
Subjektive Tatbestandsvoraussetzungen
Bei § 95 StGB handelt es sich um ein Vorsatzdelikt. Der Täter muss zumindest mit bedingtem Vorsatz in Bezug auf sämtliche objektiven Tatbestandsmerkmale handeln – er muss es also ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden, dass ein Unglücksfall oder eine Gemeingefahr, eine konkrete Gefahr einer zumindest beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung vorliegen und dass die Hilfeleistung offensichtlich erforderlich, möglich und zumutbar ist.
Entschuldigungsgrund: Zumutbarkeit
Die Schuld setzt überdies die Zumutbarkeit der Hilfeleistung voraus. Die Hilfeleistung ist insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie nur unter Gefahr für Leib oder Leben oder unter Verletzung anderer ins Gewicht fallender Interessen möglich wäre.
Die Prüfung der Zumutbarkeit darf dennoch nicht ausschließlich an den individuellen Interessen des Verpflichteten anknüpfen. Vielmehr sind sämtliche Umstände einzubeziehen, die für einen gewissenhaften und mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen in der Lage des Täters maßgeblich wären. Dazu zählen bspw die Art und Umfang der bei Unterlassung drohenden Schäden an Leib oder Leben und der Einfluss auf die Rettungschancen. Ist eine eigenhändige Hilfeleistung nicht zumutbar, so bleibt der Täter zumindest verpflichtet, sachkundige Hilfe einzuholen, etwa durch die Verständigung des Rettungsdienstes.
Aus medizinrechtlicher Sicht ist zu beachten, dass sich Personen, die bereits aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften zur Hilfeleistung verpflichtet sind (z. B. Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute, Exekutivbeamte), grundsätzlich nicht auf die Unzumutbarkeit berufen können. Für sie gelten erhöhte Zumutbarkeitsanforderungen, da von ihnen ein höheres Maß an Hilfeleistung erwartet werden darf als von durchschnittlichen Personen.
Worin liegt der Unterschied zum Imstichlassen eines Verletzten
Während das Delikt des Imstichlassens eines Verletzten (§ 94 StGB) eine vom Täter selbst verursachte Verletzung voraussetzt und daher als Sonderdelikt zu qualifizieren ist, begründet das Delikt der Unterlassenen Hilfeleistung (§ 95 StGB) eine allgemeine Pflicht, die jeden trifft.
Davon abzugrenzen sind Konstellationen, in denen eine sogenannte Garantenstellung (§ 2 StGB) besteht, wie etwa bei behandelnden Ärzten. Dem Garanten obliegt die Verantwortung, das Eintreten eines tatbestandlichen Erfolges zu verhindern. In solchen Fällen kann ein Unterlassen sogar als (fahrlässige) Körperverletzung oder Tötung durch Unterlassen strafbar sein.
Welche Strafe droht bei einem Verstoß?
Unterlassene Hilfeleistung ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bedroht.
Wenn die Unterlassung der Hilfeleistung jedoch den Tod des Menschen zur Folge hat, erhöht sich die Strafdrohung auf eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen.
Unterstützung durch einen Strafverteidiger bei Vorwürfen wegen unterlassener Hilfeleistung
Ein auf Strafrecht spezialisierter Rechtsanwalt kann in einem Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung nach § 95 StGB eine große Hilfe sein. Schon zu Beginn des Ermittlungsverfahrens verschafft er sich durch Akteneinsicht einen vollständigen Überblick über die Beweislage und die von Polizei oder Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe. Auf dieser Grundlage entwickelt er eine maßgeschneiderte Verfahrensstrategie, die die konkrete Situation des Mandanten berücksichtigt und auf den bestmöglichen Verfahrensausgang ausgerichtet ist.
Besonders wichtig ist die konsequente Wahrung der Beschuldigtenrechte. Der Strafverteidiger begleitet Vernehmungen, sorgt dafür, dass keine nachteiligen Aussagen unbedacht gemacht werden, und achtet auf die Einhaltung sämtlicher prozessualer Vorgaben.Weiters prüft er eingehend, ob eine fehlerhafte rechtliche Qualifikation durch die Ermittlungsbehörden vorliegt, und übernimmt die vollständige Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden.
Ein erfahrener Strafverteidiger stellt sicher, dass zentrale Fragen wie die Erforderlichkeit der Hilfe und deren tatsächliche Möglichkeit sowie die Zumutbarkeit im Einzelfall rechtlich fundiert aufgearbeitet werden. Auf diese Weise wird nicht nur das Risiko einer Verurteilung verringert, sondern auch der Weg für eine mögliche Verfahrenseinstellung oder diversionelle Lösung eröffnet.