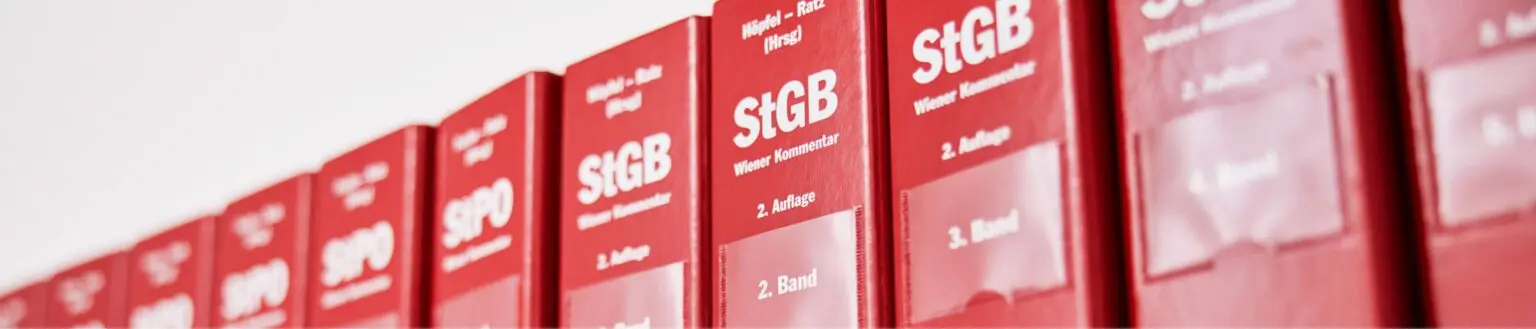Ärztliche Verschwiegenheit – Was bedeutet sie?
Die ärztliche Verschwiegenheit zählt zu den zentralsten Grundsätzen im österreichischen Gesundheitsweisen (§ 54 Abs 1 ÄrzteG 1998). Sie gilt für alle Ärzte, unabhängig davon, in welcher Fachrichtung ein Arzt spezialisiert oder ob er selbständig in einer Praxis oder angestellt in einem Spital tätig ist. Demnach obliegt es Ärzten sowie deren Hilfspersonen, jegliche Informationen, die im Rahmen der Berufsausübung erlangt werden, vertraulich zu behandeln. Dazu zählen insbesondere:
- Gesundheitsdaten, Diagnosen und Untersuchungsergebnisse,
- Persönliche oder familiäre Informationen,
- Informationen aus vertraulichen Gesprächen mit Patienten.
Dritte – also auch Angehörige, Versicherungen oder andere Ärzte – dürfen diese Informationen nur erhalten, wenn die betroffene Person ausdrücklich zustimmt. Eine Weitergabe ohne Einwilligung ist grundsätzlich verboten.
Wann darf die ärztliche Verschwiegenheitspflicht durchbrochen werden?
Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht ist das Fundament des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Ärzten und Patienten – sie gilt jedoch nicht grenzenlos. In bestimmten Situationen erlaubt das Gesetz die Schweigepflicht auszusetzen, wenn besonders gewichtige Interessen auf dem Spiel stehen.
Eine Offenlegung von Patienteninformationen kann bspw dann zulässig sein, wenn sie nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der Rechtspflege oder öffentlichen Gesundheit unbedingt erforderlich ist (§ 54 Abs 2 ÄrzteG). Im Strafprozess selbst gibt es kein generelles Aussageverweigerungsrecht für Ärzte (§ 157 StPO). Eine Ausnahme gilt lediglich für Fachärzte für Psychiatrie, die über in Ausübung ihrer Tätigkeit erlangte Informationen die Aussage verweigern dürfen (§ 157 Abs 1 Z 3 StPO).
Ärzte als Zeugen im Strafverfahren: Pflicht zur Aussage – aber nicht ohne Grenzen
Zeugen haben die Pflicht, wahrheitsgemäß und vollständig auszusagen. Diese Verpflichtung betrifft selbstverständlich auch Ärzte. Sie müssen einer Ladung zur Vernehmung Folge leisten und richtige und vollständige Angaben machen – andernfalls droht eine Strafbarkeit wegen falscher Beweisaussage (§ 288 StGB).
Eine Entbindung von der Schweigepflicht durch Patienten ist dabei keine Voraussetzung für die Aussage.
Allerdings setzen sowohl das Ärztegesetz als auch die Strafprozessordnung klare Grenzen:
- Die Aussage hat sich auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken.
- Ärzte haben – so wie jede andere Person auch – jederzeit das Recht zu schweigen, wenn sie sich mit der Beantwortung einer Frage selbst belasten würden (§ 7 Abs 2 StPO).
- Einzelne Fragen, die den eigenen höchstpersönlichen Lebensbereich oder jenen eines Patienten betreffen – etwa Gesundheit, Sexualleben oder familiäre Umstände – dürfen verweigert werden (§ 158 Abs 1 Z 3 StPO), sofern sie nicht zwingend notwendig sind, um über Schuld oder Unschuld zu entscheiden.
Damit schützt das Gesetz sowohl das Vertrauensverhältnis zum Patienten als auch das öffentliche Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung – ein Balanceakt, der in der Praxis oft rechtliche Beratung durch einen erfahrenen Strafverteidiger erfordert.
Das Aussageverweigerungsrecht von Fachärzten für Psychatrie
Ärzten aus der Fachrichtung der Psychiatrie steht ein Aussageverweigerungsrecht zu (§ 157 Abs 1 Z 3 StPO). Dieses bezieht sich jedoch ausschließlich auf Informationen, die der Arzt für Psychiatrie im Rahmen seiner Tätigkeit erlangt hat. Darunter fallen bspw geheime Mitteilungen, welche an den Facharzt für Psychiatrie gerade aufgrund seiner Tätigkeit herangetragen wurden.
Der Arzt aus der Fachrichtung der Psychiatrie trifft einzig und allein die Entscheidung, ob er eine Aussage zu Protokoll gibt oder dieses verweigert. Man kann ihn nicht zwingen, die Aussage zu verweigern. Es handelt sich um ein höchstpersönliches Recht des Betroffenen. Selbst bei Entbindung seiner Verschwiegenheitspflicht steht es dem Facharzt frei, Gebrauch von seinem Aussageverweigerungsrecht zu machen.
Bei dieser Entscheidung hat er genau abzuwägen, ob im konkreten Fall das Geheimhaltungsinteresse einer einzelnen Person oder das öffentliche Interesse der Strafverfolgung überwiegt. Wiederum hat der Facharzt für Psychiatrie seine Aussagen auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.
Kommt der Arzt aus dem Fachbereich der Psychiatrie zum Ergebnis, dass das persönliche Geheimhaltungsinteresse des Patienten überwiegt, so hat er seine Verschwiegenheitspflicht zu wahren. Wenn er in diesem Fall nicht auf sein Aussageverweigerungsrecht nach § 157 Abs 1 Z 3 StPO verweist, drohen ihm selbst rechtliche Konsequenzen.
Das Aussageverweigerungsrecht darf auch nicht umgangen werden – etwa durch die Sicherstellung und Beschlagnahme von Kommunikation zwischen Patienten und behandelndem Psychiater (§ 157 Abs 2 StPO).
Weitere Personen im Gesundheitswesen, die ein Aussageverweigerungsrecht haben
Neben Psychiatern haben auch Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer, eingetragene Mediatoren und Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist, das Recht, die Aussage zu verweigern.
Amtsärzte: Keine ärztliche Verschwiegenheit und dennoch Geheimhaltungspflichten
Bezüglich ihrer amtsärztlichen Tätigkeit gilt die Verschwiegenheitspflicht nach § 54 Abs 1 ÄrzteG 1998 nicht für Amtsärzte. Hier muss jedoch beachtet werden, dass diese Personen an die für sie geltende gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen gebunden sind. Eine solche findet sich bspw in § 46 Abs 1 BDG (Beamtendienstgesetz). Im Strafverfahren gilt für Amtsärzte, die als Beamte klassifiziert werden, ein Zeugenvernehmungsverbot nach § 155 Abs 1 Z 2 StPO.
Eine Aussage darf nur erfolgen, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zuvor von der Geheimhaltungsverpflichtung entbindet oder die Wahrnehmung im Dienste der Strafrechtspflege (§ 155 Abs 2 StPO) gemacht wurde.
Bei Fehlen einer Entbindung dürfen Amtsärzte nicht über Umstände befragt werden, hinsichtlich derer sie gesetzlich zur Geheimhaltung verpflichtetsind.
Ärzte als Beschuldigte: Recht auf Schweigen
Wird ein Arzt beschuldigt, ein Fehlverhalten gesetzt zu haben, drohen im Rahmen der Arzthaftung sowohl zivilrechtliche als auch medizinstrafrechtliche Konsequenzen. Bei einem strafrechtlichen Vorwurf gilt ein genereller zentraler Grundsatz im Strafrecht: Der Beschuldigte darf nicht gezwungen werden, sich selbst zu belasten (Selbstbezichtigungsverbot). Es steht ihm jederzeit frei, die Aussage zu verweigern.
Wollen sich Ärzte als Beschuldigte aktiv entlasten, etwa durch Offenlegung bestimmter Patienteninformationen, ist besondere Vorsicht geboten. Es ist eine sorgfältige Interessensabwägung durchzuführen. Eine Offenbarung darf nur erfolgen, wenn sie zur eigenen Verteidigung unbedingt erforderlich ist und die Verteidigungsinteressen schwerer wiegen als die Pflicht zur Verschwiegenheit. Selbst dann darf nur das preisgegeben werden, was zwingend notwendig ist.
Im Zweifel sollte eine solche Entscheidung immer gemeinsam mit einem erfahrenen, auf Strafrecht spezialisierten Rechtsanwalt getroffen werden, um rechtliche Risiken und mögliche Pflichtverletzungen zu vermeiden.
Strafverteidigung im Medizinstrafrecht
Im Medizinstrafrecht kann der richtige juristische Beistand entscheidend sein. Schon im frühen Stadium eines Ermittlungsverfahrens ist es wichtig, einen erfahrenen Strafverteidiger beizuziehen – denn viele Weichen für den weiteren Verlauf eines Strafverfahrens werden bereits in dieser Phase gestellt.
Ein spezialisierter Strafverteidiger nimmt laufend Akteneinsicht, entwickelt eine klare Verteidigungsstrategie und bereitet gemeinsam mit dem betroffenen Arzt eine schriftliche Stellungnahme vor.
Darüber hinaus achtet ein erfahrener Rechtsanwalt darauf, dass alle Beschuldigtenrechte sowie der Rechtsschutz gewahrt bleiben – etwa durch rechtzeitig eingebrachte Beweisanträge im Strafverfahren oder den Einsatz geeigneter Rechtsmittel.
In manchen Fällen kann bereits früh im Stadium des Ermittlungsverfahrens eine Einstellung des Strafverfahrens erreicht werden. Das hilft, den Ruf und die berufliche Zukunft zu schützen sowie mögliche zivilrechtliche Folgen aus der Arzthaftung bestmöglich zu verhindern.