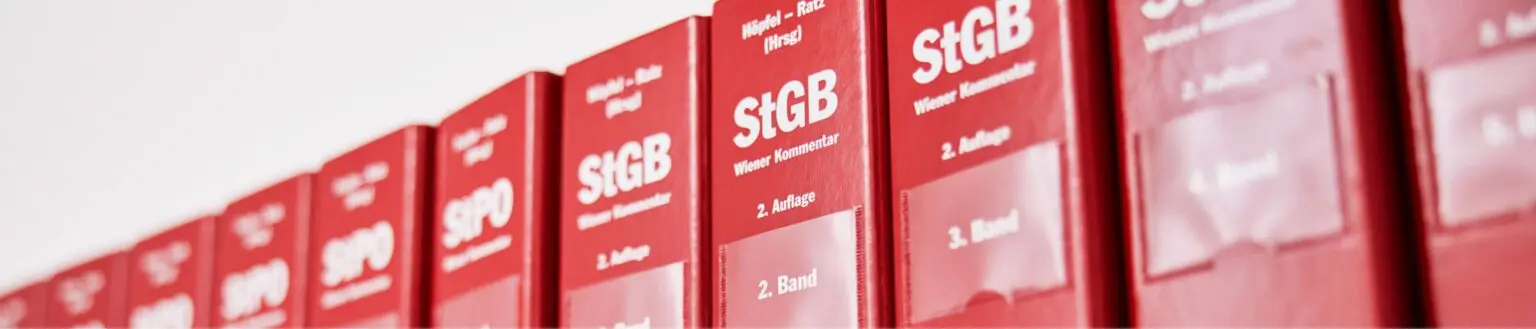Ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU (§ 168f StGB)
Kerngedanke und Anwendungsbereich
Wer in Bezug auf Ausgaben, die nicht in Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe stehen, Mittel oder Vermögenswerte aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union oder aus den Haushalten, die im Auftrag der EU verwaltet werden,
- unter Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen oder unter Verletzung, einer spezifischen Informationspflicht unrechtmäßig erlangt oder zurückbehalt, oder
- zu anderen Zwecken als jenen, für die sie ursprünglich gewährt wurden, missbräuchlich verwendet,
begeht den Straftatbestand des ausgabenseitigen Betrugs zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union gemäß § 168f StGB.
Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU in Bezug auf Ausgaben, die in Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe stehen, mit dem Vorsatz begeht, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern. Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge sind in diesem Zusammenhang alle Ausgaben in Verbindung mit öffentlichen Aufträgen im Sinne des Art. 101 Abs. 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union.
Der Tatbestand des § 168f StGB schützt demnach EU-Haushaltsmittel auf der Ausgabenseite sowie die von der EU geförderten Zwecke und Lenkungsinteressen. Besonders praxisrelevant sind Förderungen und Zuwendungen, sei es im Rahmen klassischer Projektförderungen oder im Kontext öffentlicher Aufträge. Es ist zu beachten, dass nicht nur die unrechtmäßige Erlangung solcher Mittel, sondern auch deren zweckwidrige Verwendung strafbar ist. In der Praxis reicht das Spektrum von gefälschten Abrechnungen und unrichtigen Verwendungsnachweisen bis zur bewussten Umleitung bewilligter Gelder in nicht gedeckte Projektteile.
Strafrahmen und Schwellenwerte
Der Grundtatbestand sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen vor. Überschreitet der Schaden eine Wertgrenze von 5.000 Euro oder liegt eine Begehung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor, erhöht sich der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ab einem Schaden von mehr als 100.000 Euro drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe, bei einem Schaden von mehr als 300.000 Euro ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.
Beispiel
Ein Unternehmen beantragt EU-Fördermittel für ein Forschungsprojekt. In den Abrechnungen finden sich konsequent überhöhte Personalkosten und inhaltlich nicht gedeckte Fremdleistungen sowie gefälschte Rechnungen; zugleich werden Teile des Budgets in ein anderes Vorhaben verschoben. Der Straftatbestand des § 168f StGB ist verwirklicht.
Missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU (§ 168g StGB)
Adressatenkreis und tatbestandlicher Fokus
Das Delikt der missbräuchlichen Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU ist ein Sonderdelikt und kann nur von einem Amtsträger begangen werden, der mit der Verwaltung, Bindung oder Zuweisung von EU-Mitteln betraut ist, und diese zweckwidrig verwendet.
Konkret macht sich nach dieser Strafbestimmung strafbar, wer als Amtsträger unmittelbar oder mittelbar Mittel oder Vermögenswerte verwaltet und diese Mittel entgegen ihrer Zweckbestimmung bindet oder ausbezahlt oder sonstige Vermögenswerte entgegen ihrer Zweckbestimmung zuweist oder verwendet und dadurch die finanziellen Interessen der Union schädigt.
Auch durch dieses Delikt sollen die Vermögensinteressen der Europäischen Union geschützt werden. Gerade in Behörden, zwischengeschalteten Stellen oder Förderagenturen entstehen Konstellationen, in denen interne Zuweisungs- oder Prüfprozesse strafrechtliche Relevanz erhalten, wenn die Zweckbindung erkennbar verletzt wird.
Strafdrohungen und Abgrenzungen
Die vorgesehenen Strafrahmen entsprechen im Wesentlichen jenen des § 168f StGB. Gemäß dem Grundtatbestand droht eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten beziehungsweise 360 Tagessätzen. Ab einem Schaden von 5.000 Euro oder bei Bestehen einer kriminellen Vereinigung ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren angedroht. Die weiteren Strafdrohungen stellen sich wie folgt dar: Bei einem Schaden ab 100.000 Euro droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, bei einem Schaden von mindestens 300.000 Euro eine Freiheitsstrafe von ein bis zehn Jahren.
Beispiel
Ein Amtsträger, der zur Vergabe von EU-Förderungen berechtigt ist, vergibt ohne nähere Prüfung eine Förderung an einen Bekannten, obwohl dieser die Voraussetzungen für eine Förderung möglicherweise nicht erfüllt. Kommt es dadurch zu einer Vermögenseinbuße beim EU-Haushalt, liegt der Verdacht einer missbräuchlichen Verwendung nahe. Für die Verteidigung ist dann entscheidend, ob die Zweckbindung tatsächlich verletzt wurde, ob Ermessensspielräume bestanden und ob sich der behauptete Schaden konkret und kausal nachweisen lässt.
Compliance-Maßnahmen für Unternehmen und Verbände
Ein wirksames Compliance– und internes Kontrollsystem reduziert das Risiko, mit den oben genannten Straftatbeständen in Berührung zu kommen, erheblich. Zu Beginn steht eine zentrale Frage im Fokus: In welchen Bereichen fließen Fördergelder, Aufträge und Waren oder Dienstleistungen über die Grenze – und wo könnten potenzielle Risiken liegen? Auf dieser Grundlage sind klare Zuständigkeiten, das Vier-Augen-Prinzip und nachvollziehbare, schriftlich festgehaltene Entscheidungen erforderlich.
Die Zweckbindung von EU-Mitteln muss sich im beruflichen Alltag wiederfinden. Dies kann sich durch folgende Maßnahmen niederschlagen: die getrennte Führung von Projektkostenstellen, die Sperrung von Budgets im Buchhaltungssystem, die zeitnahe Erbringung von Verwendungsnachweisen, laufende Nachkontrollen („Post-Award-Monitoring“) und stichprobenartige Prüfungen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einfache Frühwarnsignale zu nutzen, wie beispielsweise ungewöhnlich hohe Margen, starke Preisschwankungen, neue und unbekannte Hochrisiko-Lieferanten oder auffällige Zahlungsströme.
Zusätzlich sind ein verlässliches Hinweisgebersystem, passende Schulungen und Workshops sowie klare Meldewege zu Förderstellen und Behörden erforderlich. Eine lückenlose Dokumentation ist dabei von entscheidender Bedeutung. Wer seine Prozesse sauber belegen kann, entkräftet oftmals Vorwürfe von Vorsatz und überhöhten Schadensannahmen.
Unterstützung durch einen Strafverteidiger
In Verfahren des Europastrafrechts ist die frühzeitige Einbindung eines spezialisierten Strafverteidigers empfehlenswert. Die Materie verbindet Strafrecht mit Vergabe‑, Beihilfe‑ und Haushaltsrecht, oft über mehrere Staaten hinweg. Zudem ist für Ermittlungen wegen ausgabenseitigem Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union (§ 168f StGB) und wegen missbräuchlicher Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union (§ 168g StGB) die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) zuständig, für die eigene Vorgaben gelten, die ein versierter Verteidiger kennen sollte.
Schon anfängliche Entscheidungen – wie mit Durchsuchungen, Auskunftsverlangen, internen Abklärungen oder Anfragen von Förderstellen umgegangen wird – prägen den weiteren Verlauf. Anwaltliche Vertretung stellt sicher, dass Beschuldigtenrechte im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gewahrt, Kommunikationswege geordnet und Risiken richtig eingeordnet werden: Es geht um die saubere Einordnung des Sachverhalts, die belastbare Prüfung von Tatbeständen und Schadensberechnung. Im Bedarfsfall sollten die erforderlichen Rechtsmittel erhoben werden, um die eigenen Reche zu schützen.
Ziel ist nicht bloß, das bestmögliche Ergebnis im Strafverfahren, von der Verfahrenseinstellung über Diversion bis hin zu einer milden Strafe, zu erreichen, sondern insbesondere auch die Verhinderung von Reputationsschäden.