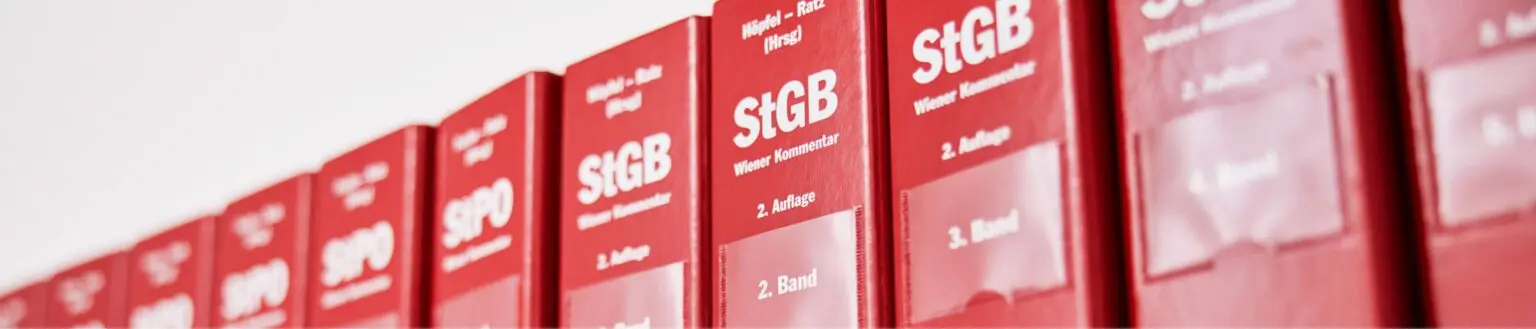Allgemeines
Der Kerngehalt der Bestimmung ist ohne Weiteres nachvollziehbar: Geschützt werden sowohl das menschliche Leben als auch die körperliche Unversehrtheit. Nach Verursachung einer Körperverletzung trifft den Täter eine persönliche Pflicht zur Hilfeleistung. Diese Verpflichtung erlangt besondere Bedeutung im Gesundheitsbereich (etwa bei Behandlungsfehlern oder Komplikationen nach medizinischen Eingriffen), gilt jedoch ebenso für Alltagssituationen wie Verkehrsunfälle oder betriebliche Konstellationen (z. B. Arbeitsunfälle).
§ 94 StGB stellt ein echtes Unterlassungsdelikt dar. Es genügt daher bereits eine pflichtwidrige Untätigkeit; der Eintritt eines konkreten Erfolges – etwa der Tod der verletzten Person – ist nicht erforderlich.
Tatbestandsmerkmale des § 94 StGB
Objektiver Tatbestand
Wer es unterlässt, einem anderen, dessen Verletzung am Körper (§ 83 StGB) er, wenn auch nicht widerrechtlich (z.B durch Notwehr), verursacht hat, die erforderliche Hilfe zu leisten, begeht das Delikt des Imstichlassen eines Verletzten.
Wer kann Täter sein?
§ 94 StGB ist ein Sonderdelikt. Das bedeutet, dass unmittelbarer Täter nur der Verursacher der vorangegangenen fahrlässigen oder vorsätzlichen Körperverletzung sein kann. Dabei reicht bloße Mitursächlichkeit grundsätzlich aus. Eine Person, die gerechtfertigt verletzt, also keine strafbare Handlung setzt (zB Notwehr bzw Nothilfe), bleibt nichtsdestotrotz grundsätzlich hilfepflichtig.
Erforderlichkeit der Hilfeleistung
Die Erforderlichkeit einer Hilfeleistung bestimmt sich nach der Hilfsbedürftigkeit der verletzten Person. Eine solche ist gegeben, wenn ein vernünftiger, einsichtiger Mensch in der konkreten Situation ärztliche oder sonstige Hilfe in Anspruch nehmen würde. Grundsätzlich begründen Verletzungen die Annahme einer Hilfsbedürftigkeit. Davon ausgenommen sind jedoch bloße Bagatellverletzungen, wie etwa kleinere Schürf- oder Schnittwunden sowie leichte Prellungen oder Verstauchungen, die als vernachlässigbar einzustufen sein können.
Maßgeblich ist stets der objektiv gewonnene Gesamteindruck. Hilfsbedürftigkeit ist gegeben, wenn ein gewissenhafter und umsichtiger Beobachter unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Person der Hilfe bedarf.
Auch bei einer Person, die sich bereits im Sterben befindet und daher nicht mehr gerettet werden kann, kann Hilfsbedürftigkeit gegeben sein. Dabei ist zumindest psychischer Beistand zu leisten, um die Lage für die betroffene Person zu erleichtern.
In welcher Form ist Hilfe zu leisten?
Grundsätzlich muss der Verursacher der Verletzung die Hilfeleistung selbst und unverzüglich erbringen (persönliche Pflicht). Die Pflicht entfällt erst dann, wenn die Verletzte Person ausreichend sachkundige Hilfe (durch einen Arzt oder Rettungskräfte) durch Dritte erhält. Das bloße Verständigen der Rettung bzw das Absetzen des Notrufes ist für sich alleine grundsätzlich nicht ausreichend, um die persönliche Pflicht zu erfüllen.
Unter „Hilfe“ ist jede Handlung zu verstehen, die geeignet ist, die Lage des Verunglückten zu erleichtern und insbesondere seine Schmerzen zu lindern. Welche Maßnahmen im konkreten Fall zu ergreifen sind, richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Grundsätzlich umfasst die Hilfeleistung zunächst die gebotenen Maßnahmen der Ersten Hilfe sowie in weiterer Folge die Herbeiführung ärztlicher Unterstützung.
Aus dem Tatbestand ergibt sich eine Überzeugungspflicht des Verursachers, sofern er es zumindest ernstlich für möglich hält, dem Opfer eine Verletzung zugefügt zu haben. Eine ausdrückliche Pflicht zur aktiven Nachschau, ob das Opfer tatsächlich Hilfe benötigt, besteht hingegen nicht.
Die Hilfeleistung muss dem Verursacher auch tatsächlich möglich sein. Wird der Verletzende vom Erbringen der Hilfeleistung bspw durch das Festhalten einer anderen Person oder durch eine eigene schwere Verletzung gehindert, ist ihm die Hilfeleistung nicht möglich.
Subjektiver Tatbestand
§ 94 StGB ein Vorsatzdelikt. Der Täter muss zumindest mit bedingten Vorsatz die objektiven Tatbestandsmerkmale erfüllen. Er muss es demnach ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden, die Verletzung eines anderen verursacht zu haben und die benötigte Hilfeleistung zu unterlassen.
Entschuldigungsgrund: Zumutbarkeit
Auf Schuldebene gibt es nach § 94 Abs 3 StGB ein Entschuldigungsgrund. Der Täter ist demnach entschuldigt, wenn ihm die Hilfeleistung nicht zumutbar ist. Unzumutbar ist Hilfe vor allem bei gravierender Eigengefährdung. Das ist der Fall, wenn man sich selbst der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung aussetzten müsste oder die Hilfeleistung nur bei Verletzung anderer überwiegender Interessen möglich wäre. Dabei ist eine Interessensabwägung im Einzelfall vorzunehmen. Eine Angst vor einer Anzeige, Karrierenachteilen oder wirtschaftlichen Einbußen begründet keine Unzumutbarkeit und entschuldigt daher nicht.
Verzicht des Opfers auf die Hilfeleistung
Das Opfer kann unter Umständen auch auf eine Hilfeleistung verzichten. Maßgeblich ist dafür, dass der Verzicht die Kriterien eines rechtswirksamen Verzichts erfüllt. Ein gültiger Verzicht setzt voraus, dass das Opfer über eine entsprechende Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt. Diese fällt beispielweise bei einer beträchtlichen Alkoholisierung oder bei einem Schockzustand nach einem Unfall weg.
Strafdrohung und Qualifikation
Imstichlassen eines Verletzten ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen bedroht (§ 94 Abs 1 StGB).
Hat das Imstichlassen eine schwere Körperverletzung nach § 84 Abs 1 StGB des Verletzens zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, hat es einen Tod zur Folge, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Typische Fallkonstellationen aus der Praxis
- Medizinstrafrecht: Eine Patientin erscheint am Folgetag mit schweren Beschwerden nach einer nicht lege artis durchgeführten Heilbehandlung; der behandelnde Arzt weist sie schlicht ab. → Persönliche Pflicht zur konkreten Hilfe (Ersteinschätzung, Organisation ärztlicher Versorgung) statt bloßem Abwimmeln.
- Betrieblicher Unfall: Ein Mitarbeiter verursacht fahrlässig eine Körperverletzung eines Arbeitskollegen und überlässt die Abklärung Dritten, ohne sicherzustellen, dass tatsächlich Hilfe eintrifft. → Pflicht zur Hilfeleistung bleibt persönlich, bis qualifizierte Hilfe übernimmt.
Unterstützung durch einen erfahrenen Strafverteidiger
Wenn Sie mit dem Vorwurf des Imstichlassen eines Verletzten konfrontiert sind, sollten Sie unverzüglich einen auf Strafrecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren. Dieser verschafft sich durch Akteneinsicht und eine umfassende Analyse des Sachverhalts ein genaues Bild Ihres Falles. Auf dieser Grundlage entwickelt der Strafverteidiger eine sachgerechte Verteidigungsstrategie und stellt sicher, dass Ihre Rechte als Beschuldigter gewahrt bleiben.
Darüber hinaus steht ein Strafverteidiger Ihnen in sämtlichen Fragen rund um das Strafverfahren, das zugrunde liegende Delikt sowie mögliche Entschuldigungsgründe beratend und unterstützend zur Seite. Auf Basis der Akteneinsicht prüft er insbesondere, ob eine Hilfeleistung tatsächlich erforderlich, möglich und zumutbar war. Außerdem sorgt für eine sorgfältige Dokumentation und gewährleistet, dass die prozessualen Rechte des Betroffenen in vollem Umfang geschützt werden.