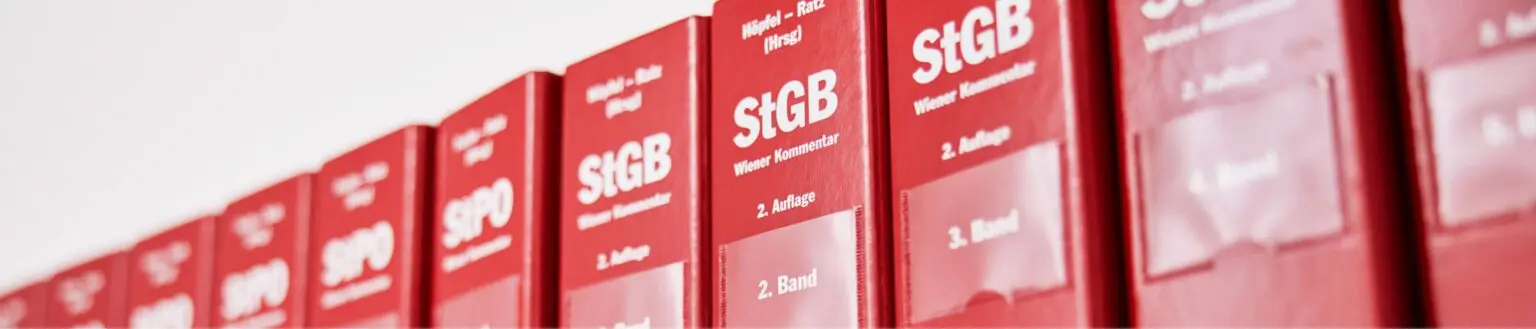Speichermedien
Die Reform markiert eine deutliche Abkehr von der zuvor zwingenden Gegenstandsbezogenheit der Sicherstellung. Während bisher sämtliche körperlichen Gegenstände (beispielsweise Mobiltelefone oder die Mordwaffe) gleich behandelt und als solche sichergestellt werden konnten, unterscheidet das Gesetz nun explizit zwischen der Sicherstellung analoger Gegenstände und der Beschlagnahme von Datenträgern und Daten. Die Neureglung gilt nicht nur Handys oder Laptops, sondern auch CDs, USB-Sticks und sämtliche weiteren Speichermedien. Betroffen sind nicht nur jene Daten, die sich auf dem Endgerät befinden, sondern auch externe Speicherorte (zB Cloud).
Richtervorbehalt und Einschränkung der auszuwertenden Daten
Eine von der Staatsanwaltschaft – ohne vorherige richterliche Bewilligung – angeordnete Sicherstellung zur Auswertung umfangreicher Datenmengen auf Endgeräten ist nach der neuen Rechtslage nicht mehr zulässig. Die Neuregelung sieht vor, dass bereits vor Begründung der Verfügungsmacht über einen Datenträger eine gerichtliche Bewilligung der staatsanwaltschaftlichen Anordnung eingeholt werden muss, sofern eine Auswertung von Daten geplant ist (§ 115f Abs 2 StPO). Lediglich bei Gefahr im Verzug darf die Kriminalpolizei zunächst ohne vorherige Bewilligung sicherstellen und auf die Daten zugreifen (§ 115f Abs 4 StPO).
Die gerichtlich bewilligte staatsanwaltschaftliche Anordnung hat die zu beschlagnahmenden Datenkategorien und –inhalte sowie die relevanten Zeiträume zu enthalten (§ 115f Abs 3 StPO). Dadurch möchte der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht den gesamten Datenbestand durchsehen dürfen.
An den materiellen Voraussetzungen für eine Maßnahme hat sich im Kern nichts geändert. Nach wie vor genügt ein strafrechlicher Anfangsverdacht, also bestimmte Anhaltspunkte, dass eine Straftat begangen worden ist (§ 1 Abs 3 StPO). Eine bestimmte Schwere der Tat wird dabei nicht vorausgesetzt. Auch unbeteiligte Dritte können weiterhin von der Maßnahme betroffen sein. Entscheidend ist allein, dass die Beschlagnahme aus Beweisgründen erforderlich erscheint und aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass dadurch Informationen ermittelt werden können, die für die Aufklärung einer Straftat wesentlich sind (§ 115f Abs 1 StPO).
Der Auswertungsprozess im Detail
Wurde die Beschlagnahme gerichtlich bewilligt, werden – meistens im Zuge einer Hausdurchsuchung – die Datenträger physisch beschlagnahmt. Daraufhin werden sämtliche auf dem Datenträger vorhandenen Daten zunächst als „Originalsicherung“ gesichert (§ 115g Abs 1 StPO). Anschließend wird anhand einer „Arbeitskopie“ jene Datenaufbereitung vorgenommen, die sich auf den bewilligten Umfang beschränkt (etwa hinsichtlich bestimmter Zeiträume oder Datenkategorien).
Die Aufbereitung von Daten umfasst alle technischen Schritte, insbesondere auch jene zur Wiederherstellung von Daten und zur Einschränkung auf den richterlich bewilligten Umfang (§ 109 Z 2b StPO). Nach erfolgter Aufbereitung ist ein eigenständiger Aufbereitungsbericht zu erstellen (§ 115h Abs 1 StPO).
In einem nächsten Schritt folgt die konkrete Auswertung des Ergebnisses Datenaufbereitung (§ 115i Abs 1 StPO). Das Ergebnis der Datenaufbereitung, also ein der gerichtlichen Entscheidung in Bezug auf die Datenkategorien und den Zeitraum entsprechender Datensatz (§ 109 Z 2e StPO) ist in weiterer Folge inhaltlich auszuwerten.
Die Strafverfolgungsbehörden können zu diesem Zweck Suchparameter definieren, die im Akt zu protokollieren sind. Beschuldigte sowie Opfer haben die Möglichkeit, zusätzliche Suchparameter und die Löschung nicht relevanter Daten zu beantragen (§ 115i Abs 2 und Abs 5 StPO). Zudem haben Beschuldigte und Opfer das Recht, in das Ergebnis der Aufbereitung Einsicht zu nehmen – sofern sie von der Beschlagnahme betroffen sind. Sonstige Personen, deren Daten ausgewertet wurden, dürfen das Ergebnis der Auswertung insoweit einsehen, als es ihre eigenen Daten betrifft (§ 115i Abs 4 StPO).
Verwertbarkeit und Zufallsfunde
§ 115j Abs 1 StPO sieht vor, dass Ergebnisse der Auswertung nicht als Beweismittel verwendet werden dürfen, sofern die Beschlagnahme nicht rechtmäßig angeordnet oder bewilligt wurde. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe ist mit Nichtigkeit bedroht.
Ergeben sich im Zuge der Datenauswertung Hinweise auf eine weitere strafbare Handlung, die nicht Anlass für die Beschlagnahme von Datenträgern und Daten war (sogenannte Zufallsfunde), ist – soweit die Verwendung als Beweismittel zulässig ist – ein gesonderter Akt anzulegen (§ 115j Abs 2 StPO). Somit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass Zufallsfunde weiterhin verwendet werden dürfen.
Eine neuerliche Anordnung und Bewilligung ist in diesem Zusammenhang zulässig (und im Hinblick auf § 115j Abs 1 StPO nötig), soweit auf Grund bestimmter Tatsachen oder Umstände anzunehmen ist, dass ein weiterer Zugriff auf die Originalsicherung oder Arbeitskopie erforderlich ist und die Voraussetzungen für die Beschlagnahme von Datenträgern und Daten vorliegen (§ 115f Abs 5 StPO).
Rolle des Rechtsschutzbeauftragten
Eine wesentliche Neuerung besteht in der erweiterten Aufsichts- und Kontrollfunktion des Rechtsschutzbeauftragten (§ 115l StPO). Die Staatsanwaltschaft hat den Rechtsschutzbeauftragten über jede erfolgte Bewilligung einer Beschlagnahme von Datenträgern und Daten zu informieren. In Fällen, in denen sich die Beschlagnahme gegen Personen mit Aussageverweigerungsrecht oder Personen, deren Einvernahme als Zeuge unzulässig ist, richtet, ist zusätzlich seine Ermächtigung erforderlich, die nur bei besonders schwerwiegenden Gründen erteilt werden darf, die den damit verbundenen Eingriff als verhältnismäßig erscheinen lassen (§ 115l Abs 1 StPO).
Für seine Aufgaben hat der Rechtsschutzbeauftragte umfassende Befugnisse: Er erhält Einsicht in relevante Akten und darf die Aufbereitung sowie Auswertung überwachen. Hierfür darf er alle relevanten Räumlichkeiten betreten und Einsicht in die entsprechenden Unterlagen nehmen.
Der Rechtsschutzbeauftragte hat insbesondere darauf zu achten, dass bei der Aufbereitung und der Auswertung von Daten die Anordnung und die gerichtliche Bewilligung nicht überschritten werden. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft kann der Rechtsschutzbeauftragte die genannten Prüfungen vornehmen; ein Recht auf Anregung kommt auch dem Beschuldigten, dem Opfer und von der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen zu. Der Rechtsschutzbeauftragte hat mitzuteilen, ob er einer solchen Anregung nachkommt; diese Mitteilung hat eine Begründung zu enthalten (§ 115l Abs 3 StPO).
Der Rechtsschutzbeauftragte ist auch befugt, Beschwerde (§ 87 StPO) oder Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 106 StPO) zu erheben und die Vernichtung von Daten zu beantragen. Nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahme ist ihm Gelegenheit zu bieten, sich von der ordnungsgemäßen Vernichtung der Originalsicherung, der Arbeitskopie und des Ergebnisses der Datenaufbereitung zu überzeugen.
Praxisrelevanz und Ausblick
Die strikte Trennung zwischen einer bloß punktuellen Sicherstellung und der umfangreichen Beschlagnahme von Datenbeständen soll den massiven Eingriff in die Grundrechte auf Datenschutz (§ 1 DSG) und Privatsphäre (Art 8 EMRK) transparenter und kontrollierbarer machen. Zwar war es das erklärte Anliegen des Gesetzgebers, die Rechte der Betroffenen zu stärken; von einer gänzlich gelungenen Reform kann aber dennoch nicht die Rede sein.
Positiv hervorzuheben ist zwar die neu geschaffene Transparenz des Auswertungsvorganges, jedoch wird die Herstellung einer vollständigen „Originalsicherung“ des gesamten Datenbestandes aus grundrechtlicher Sicht kritisch gesehen. Zudem zeigt sich in der Praxis, dass Betroffenen die Datenträger oft für Wochen oder gar Monate entzogen werden, obwohl § 115f Abs 6 StPO ausdrücklich eine auf Datenkategorien und Zeiträume beschränkte Datenspiegelung bei der Durchführung der Beschlagnahme vorsieht.
Nicht minder umstritten ist die undifferenzierte Verpflichtung zur Aufbewahrung der Originalsicherung – also des gesamten Datenbestandes auf einem beschlagnahmten Datenträger – bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens (§ 115k StPO). Hier bestehen grundrechtliche und datenschutzrechtliche Bedenken. Ob die Neuregelung mit all ihren Details vor dem VfGH Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Der VfGH hat aber klargestellt, dass gerade bei der Sicherung und Auswertung umfangreicher Daten besonders strenge verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten sind, um die Grundrechte auf Privat- und Familienleben und Datenschutz nicht unverhältnismäßig zu beeinträchtigen.