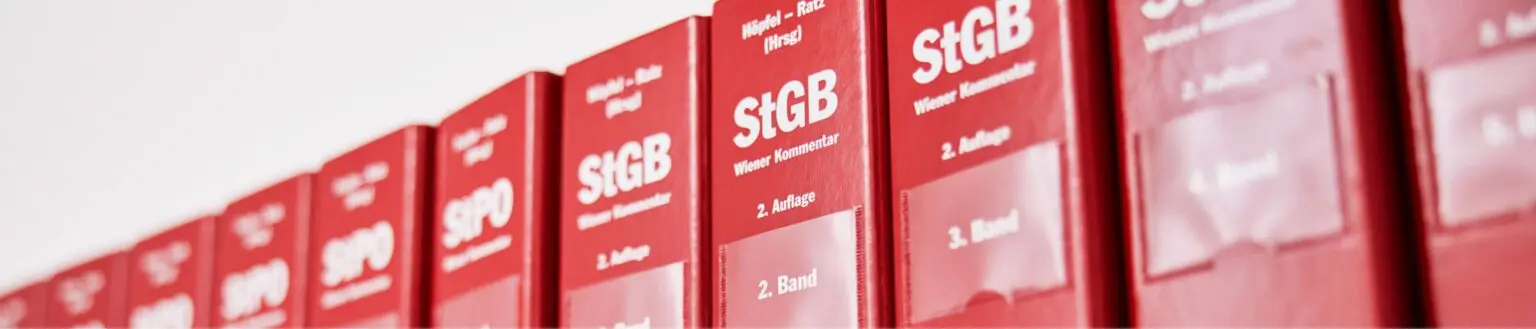Die gesetzlichen Voraussetzungen einer Einstellung
Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gemäß § 190 StPO einzustellen, wenn sich ergibt, dass
- die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist (1. Fall);
- die weitere Verfolgung des Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre (2. Fall);
- oder kein tatsächlicher Grund zu dessen weiterer Verfolgung besteht (3.Fall).
Beispiele
- 1. Fall (kein strafbares Verhalten): Dieser Fall liegt vor, wenn kein gerichtlicher Straftatbestand erfüllt ist, etwa wenn das Delikt nur verwaltungsrechtlich strafbar ist oder nicht in den Geltungsbereich der inländischen Strafgesetze fällt.
- 2. Fall (rechtliche Verfolgungshindernisse): Dieser Umstand ist dann gegeben, wenn bspw ein Rechtfertigungsgrund (zB Notwehr), ein Schuldausschließungsgrund (zB Zurechnungsunfähigkeit), ein Strafaufhebungsgrund (zB tätige Reue) oder ein prozessuales Verfolgungshindernis (zB Verbot der Doppelbestrafung) erfüllt sind.
- 3. Fall (kein tatsächlicher Grund für weitere Verfolgung): Aus diesem Grund erfolgt eine Einstellung, wenn wegen unklarer oder unvollständiger Beweislage ein Freispruch wahrscheinlicher erscheint als ein Schuldspruch und somit nicht mit einer Verurteilung zu rechnen ist.
Umfang der Einstellung
Eine Einstellung kann sich entweder auf den gesamten Sachverhalt, der den strafrechtlichen Vorwürfen zugrunde liegt, oder nur auf einen Teil dieses Sachverhalts („Teileinstellung“) beziehen.
Eine Teileinstellung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt teilbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich das Geschehen in mehrere selbständige Straftaten aufspalten lässt.
Ein Beispiel für einen teilbaren Sachverhalt ist folgende Konstellation: Person A fühlt sich von Person B provoziert und droht dieser daraufhin gefährlich. In weiterer Folge eskaliert die Situation, und Person A versetzt Person B einen Schlag ins Gesicht. Dieser Sachverhalt lässt sich in eine gefährliche Drohung (§ 107 StGB) und eine Körperverletzung (§ 83 StGB) aufteilen. In einem solchen Fall käme eine Teileinstellung in Betracht.
Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 191 StPO) und Einstellung bei mehreren Straftaten (§ 192 StPO)
Eine Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 191 StPO) ist von der Staatsanwaltschaft zu verfügen, wenn die vorgeworfene Tat mit Geldstrafe oder höchstens drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und der Störwert der Tat unter Berücksichtigung der Schuld, der Tatfolgen sowie des Verhaltens des Beschuldigten nach der Tat, insbesondere im Hinblick auf eine allfällige Schadensgutmachung, sowie weitere Umstände, die auf die Strafbemessung Einfluss hätten, als gering einzustufen ist. Voraussetzung ist zudem, dass keine spezial- oder generalpräventiven Gründe der Einstellung entgegenstehen.
Dabei ist zu betonen, dass in solchen Fällen grundsätzlich eine Strafbarkeit gegeben ist, die Tat jedoch als verfolgungsunwürdig erscheint, weil sie die Voraussetzungen der Geringfügigkeit iSd § 191 StPO erfüllt. Der Störwert ergibt sich aus einer Gesamtabwägung der Schuld, der Tatfolgen und sonstiger Strafbemessungsumstände, insbesondere der Erschwerungs- und Milderungsgründe (§§ 33, 34 StGB).
Werden einer Person mehrere Straftaten vorgeworfen, kann die Staatsanwaltschaft gemäß § 192 StPO das Verfahren hinsichtlich einzelner Delikte endgültig oder unter Vorbehalt einstellen, sofern diese Einstellung voraussichtlich keinen Einfluss auf die Strafhöhe oder eine Diversion im Hinblick auf die verbleibenden Taten hat.
Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens (§ 108 StPO)
Ein Beschuldigter hat das subjektive Recht (§ 49 Abs 1 Z 9 StPO), einen Antrag auf Einstellung bzw Teileinstellung des Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Das Ermittlungsverfahren ist gemäß § 108 Abs 2 StPO auf Antrag des Beschuldigten einzustellen, wenn
- auf Grund der Anzeige oder der vorliegenden Ermittlungsergebnisse feststeht, dass die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht oder die weitere Verfolgung des Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig ist, oder (Z 1)
- der bestehende Tatverdacht nach Dringlichkeit und Gewicht sowie im Hinblick auf die bisherige Dauer und den Umfang des Ermittlungsverfahrens dessen Fortsetzung nicht rechtfertigt und von einer weiteren Klärung des Sachverhalts eine Intensivierung des Verdachts nicht zu erwarten ist (Z 2).
§ 108 Abs 2 Z 1 StPO entspricht im Wesentlichen dem 1. und 2. Fall des § 190 StPO. Der Beschuldigte kann in seinem Antrag daher beispielsweise darlegen, dass kein gerichtlicher Straftatbestand durch seine Handlungen erfüllt ist oder dass er in gerechtfertigter Notwehr gehandelt hat.
§ 108 Abs 2 Z 2 StPO ist demgegenüber dem 3. Fall des § 190 StPO vergleichbar. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob sämtliche relevanten Beweise bereits erhoben und hinreichend gewürdigt wurden sowie ob eine hinreichende rechtliche Beurteilung des Sachverhalts bereits erfolgt ist. Auf Grundlage dieser Umstände ist eine Prognose über die Verurteilungswahrscheinlichkeit zu erstellen. Diese Prognose bildet die Basis für die Beurteilung, ob der Verdacht unter Berücksichtigung der bisherigen Dauer und des Umfangs des Ermittlungsverfahrens eine Fortsetzung der Ermittlungen rechtfertigt oder ob weitere Ermittlungsschritte voraussichtlich nicht zu einer Erhärtung des Verdachts führen würden.
Der Einstellungsantrag ist bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Diese hat das Verfahren entweder einzustellen oder den Antrag binnen vier Wochen mit einer Stellungnahme an das Gericht weiterzuleiten. Wird der Antrag innerhalb des ersten Monats ab Beginn des Strafverfahrens gestellt, beträgt die Frist sechs Wochen (§ 108 Abs 3 StPO). Das Gericht entscheidet sodann über den Antrag und hat im Falle einer Stattgebung das Strafverfahren mit Beschluss einzustellen.
Wenn die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren auf Basis des Antrags nicht einstellt, sondern mit einer Stellungnahme an das Gericht weiterleitet, kann es im Rahmen der Strafverteidigung sinnvoll sein, den Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens wieder zurückzuziehen: Einerseits erhält der Beschuldigte durch die Akteneinsicht in die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft an das Gericht einen aktuellen Anhaltspunkt, von welchem Tatverdacht die Staatsanwaltschaft derzeit ausgeht und welche Ermittlungsmaßnahmen sie derzeit noch plant und weshalb das Ermittlungsverfahren fortzuführen ist. Andererseits könnte sich eine Entscheidung des Gerichts, wonach der Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens abgewiesen wird, aus strategischer Sicht auch negativ auswirken, weil sich die Staatsanwaltschaft in der strafrechtlichen Verfolgung des Beschuldigten durch die Begründung in der Gerichtsentscheidung gestärkt sieht.
Wie kann man eine Einstellung bekämpfen?
- Einstellungsbegründung (§ 194 Abs 2 StPO
Beschuldigte und Opfer können binnen 14 Tagen ab Zustellung der Verständigung der Einstellung eine Begründung verlangen. In dieser sogenannten Einstellungsbegründung sind die Tatsachen und Erwägungen, die der Einstellung zu Grunde gelegt wurden, in gedrängter Darstellung anzuführen. - Fortführungsantrag (§ 195 StPO)
Das Opfer (§ 65 StPO) kann – oftmals in der Rolle als Privatbeteiligter – binnen 14 Tagen nach Zustellung der Einstellungsbegründung einen Fortführungsantrag bei der Staatsanwaltschaft einbringen. Wurde es von der Einstellung nicht verständigt, beträgt die Frist drei Monate ab Einstellung.
Das Gericht hat gemäß § 195 Abs 1 StPO auf Antrag des Opfers eine Fortführung eines durch die Staatsanwaltschaft eingestellten Ermittlungsverfahrens anzuordnen, wenn
- das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde (Z 1),
- erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der Entscheidung über die Beendigung zu Grunde gelegt wurden (Z 2), oder
- neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die für sich allein oder im Zusammenhalt mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den Sachverhalt soweit zu klären, dass mittels Anklage oder Diversion vorgegangen werden kann (Z 3)
Die gerichtliche Entscheidung erfolgt auf Grundlage des Verfahrensstands zum Zeitpunkt der Einstellung. Mit dem ersten Fortführungsgrund (§ 195 Abs 1 Z 1 StPO) können Rechtsfehler und Ermessensmissbrauch geltend gemacht werden, etwa weil die Staatsanwaltschaft von der fehlenden Tatbestandsmäßigkeit ausgegangen ist. Der zweite Fortführungsgrund (§ 105 Abs 1 Z 2 StPO) betrifft einen erheblich bedenklichen Ermessensgebrauch der Staatsanwaltschaft, wobei jedoch nur Fälle einer unerträglichen Beweiswürdigung durch die Staatsanwaltschaft aufgegriffen werden können. Mit dem dritten Fortführungsgrund (§ 195 Abs 1 Z 3 StPO) können auch neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden, wodurch eine maßgebliche Veränderung der Beweislage in Richtung Verurteilungswahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden kann.
Hält die Staatsanwaltschaft den Antrag für berechtigt, hat sie das Verfahren fortzuführen; andernfalls ist der Antrag mit dem Akt und einer Stellungnahme an das Gericht weiterzuleiten (§ 195 Abs 3 StPO). Das Gericht entscheidet mit Beschluss, gegen den kein Rechtsmittel zulässig ist. Vor der Entscheidung sind dem Beschuldigten und dem Fortführungswerber die Gelegenheit zur Äußerung zur Stellungnahme der Staatsanwaltschaft binnen angemessener Frist einzuräumen.
Welche Folgen hat die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens?
Nach einer Einstellung sind weitere Ermittlungen gegen den Beschuldigten zu unterlassen. Über die Einstellung sind der Beschuldigte, die Kriminalpolizei sowie Opfer zu verständigen (§ 194 StPO). Die Verständigung muss den Einstellungsgrund nennen.
Spätestens nach Zurückweisung bzw Abweisung eines Fortführungsantrags ist die Einstellung rechtswirksam. Durch Rechtswirksamkeit tritt eine Sperrwirkung ein. Wurde ein Ermittlungsverfahren rechtswirksam eingestellt („res iudicata“) darf gegen denselben Beschuldigten wegen derselben Tat grundsätzlich nicht neuerlich ein Strafverfahren geführt werden (Grundsatz ne bis in idem).
Die Fortführung eines eingestellten Ermittlungsverfahrens kann die Staatsanwaltschaft nur anordnen, solange die Strafbarkeit der Tat noch nicht verjährt ist und der Beschuldigte wegen dieser Tat nicht vernommen und kein Zwang gegen ihn ausgeübt wurde oder neue Tatsachen oder Beweismittel entstehen oder bekannt werden, die für sich allein oder im Zusammenhalt mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, die Bestrafung des Beschuldigten oder eine diversionelle Vorgehensweise zu begründen (§ 193 Abs 2 StPO).
Warum ist die Rolle der Strafverteidigung bei der Einstellung des Ermittlungsverfahrens so wichtig?
Ein Strafverteidiger kann nach Akteneinsicht und Analyse einschätzen, ob eine Einstellung des Verfahrens strategisch aussichtsreich ist. Durch eine gezielte und erfahrene Verteidigung werden von Beginn an die Einstellungsargumente verdichtet.
Der Verteidiger strukturiert den Aktenstoff, bringt präzise Stellungnahmen ein, die den Verdacht entkräften, und stellt bei Bedarf Beweisanträge (§ 55 StPO). So wird der Beschuldigte aktiv in das Verfahren eingebunden. Mit einer klaren Strategie verfolgt der Strafverteidiger das Ziel, die Voraussetzungen einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens für die Staatsanwaltschaft greifbar zu machen und aufzuzeigen, dass eine Einstellung geboten ist. Zudem achtet er darauf, dass die formellen Anforderungen der Schriftsätze erfüllt sind und kennt die maßgeblichen Kriterien der Strafverfolgungsbehörden im Einstellungsverfahren.