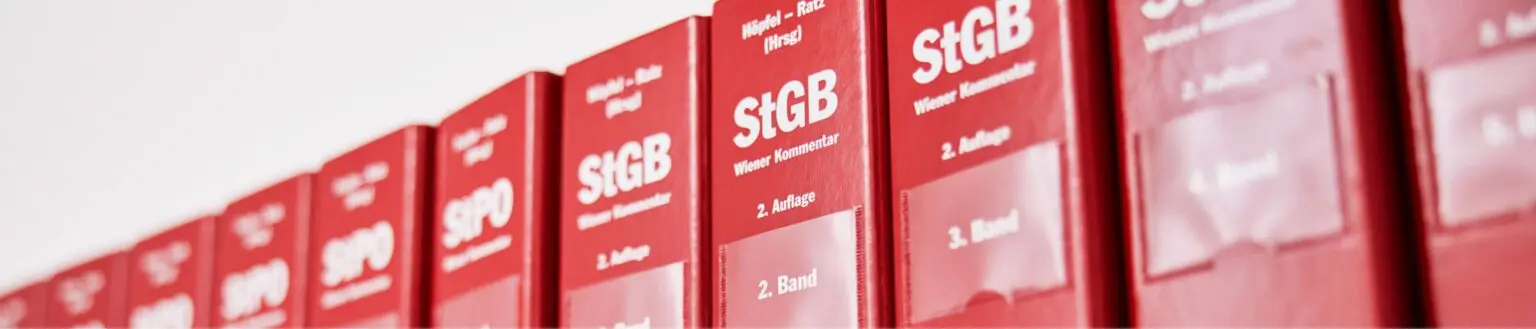Allgemeines Verständnis der Nachrichtenüberwachung
Die Legaldefinition einer „Überwachung von Nachrichten“ ist weiter gefasst, als viele annehmen. Nach § 134 Z 3 StPO versteht man darunter das Überwachen von Nachrichten und Informationen, die eine natürliche Person über ein Kommunikationsnetz oder einen Dienst der Informationsgesellschaft sendet, empfängt oder übermittelt.
Gemeint ist damit keineswegs nur das klassische Telefonat. Auch E-Mails, moderne Kommunikationsdienste, Sprachnachrichten, IP-basierte Kommunikation, der Besuch von Webseiten oder das Speichern unverschlüsselter Daten in einer Cloud können davon umfasst sein. Relevant ist dabei nicht nur der Kommunikationsinhalt im sozialen Sinn – also das gesprochene oder geschriebene Wort –, sondern auch im technischen Sinn, also jede Form von Informationsübertragung, an der zumindest eine natürliche Person beteiligt ist.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Überwachungsmaßnahmen besteht darin, dass nicht bloß Verkehrsdaten (z.B. wer wann mit wem kommuniziert hat), sondern der eigentliche Inhalt überwacht wird. Genau darin liegt der besonders intensive Eingriff in die Privatsphäre, der rechtlich nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist.
Die rechtlichen Voraussetzungen (§ 135 Abs 3 StPO)
Die Überwachung von Nachrichten ist eine sogenannte verdeckte Ermittlungsmaßnahme – also eine Maßnahme, die ohne Wissen der Betroffenen erfolgt. Damit ist sie verfahrensrechtlich besonders sensibel und unterliegt strengen Voraussetzungen, sowohl materiell als auch formell.
Zentral ist § 135 Abs 3 StPO, der vier Fallkonstellationen unterscheidet:
1. Gefährdung durch Entführung oder Freiheitsentziehung
Liegt der dringende Verdacht vor, dass eine Person, die überwacht werden soll, in eine Entführung oder ähnliche Form der widerrechtlichen Bemächtigung verwickelt ist, kann eine Überwachung von Nachrichten angeordnet werden (§ 135 Abs 3 Z 1 StPO).
2. Mit Zustimmung des Inhabers der technischen Einrichtung
Eine Überwachung von Nachrichten ist außerdem zulässig, wenn erwartet wird, dass sie zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat beiträgt, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten bedroht ist. Weitere Voraussetzung ist, dass der Inhaber der technischen Einrichtung, von der die Nachrichten stammen oder an die sie gesendet werden sollen, dieser Überwachung ausdrücklich zustimmt (§ 135 Abs 3 Z 2 StPO).
3. Ohne Zustimmung bei besonders schweren Delikten
Diese Fallgruppe betrifft Situationen, in denen die Überwachung von Nachrichten zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht ist, erforderlich erscheint oder die Aufklärung oder Verhinderung von im Rahmen einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung oder einer kriminellen Organisation (§§ 278 bis 278b StGB) begangenen oder geplanten Straftaten ansonsten wesentlich erschwert wäre (§ 135 Abs 3 Z 3 StPO). Zusätzlich muss einer der folgenden Umstände vorliegen:
- Entweder muss der Inhaber der Einrichtung selbst dringend tatverdächtig sein (lit a), oder
- es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorhanden sein, dass ein dringend Tatverdächtiger die technische Einrichtung nutzen oder eine Verbindung damit herstellen wird (lit b).
Hierbei handelt es sich um den häufigsten Anwendungsfall dieser Ermittlungsmaßnahme gegen Beschuldigte in Strafverfahren.
4. Aufenthaltsfeststellung flüchtiger Beschuldigter
Wenn ein Beschuldigter nicht auffindbar ist, kann die Nachrichtenüberwachung als Mittel zur Lokalisierung herangezogen werden. Allerdings nur dann, wenn gelindere Mittel (etwa eine Kontaktaufnahme) zuvor erfolglos geblieben sind, der Beschuldigte einer strafbaren Handlung dringend verdächtig ist, die mit mehr als einem Jahr Freiheitstrafe bedroht ist, und aufgrund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist, dass der Aufenthaltsort über eine Überwachung ermittelt werden kann (§ 135 Abs 3 Z 4 StPO).
Rechtsschutz
Die Überwachung von Nachrichten (§§ 134 Z 3, 135 Abs 3 StPO) muss auf Grundlage einer gerichtlichen Bewilligung von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden (§ 137 Abs 1 StPO). Diese richterliche Kontrolle ist essenzieller Bestandteil des Rechtsschutzsystems. Die Prüfung umfasst insbesondere die Fragen der Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit.
Darüber hinaus besteht eine Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person nach Abschluss der Maßnahme. Diese Benachrichtigung eröffnet dem Betroffenen die Möglichkeit, gegen die Maßnahme nachträglich rechtlich vorzugehen – etwa im Rahmen einer Beschwerde (§ 87 StPO) oder eines Einspruchs wegen Rechtsverletzung (§ 106 StPO).
Zudem hat der Gesetzgeber aufgrund des besonders eingriffsintensiven Charakters dieser Ermittlungsmaßnahme Beweisverwendungsverbote normiert. Als Beweismittel dürfen Ergebnisse in den Fällen des § 135 Abs 3 Z 2 bis Z 4 StPO, bei sonstiger Nichtigkeit, nur zum Nachweis einer vorsätzlich begangenen strafbaren Handlung, derentwegen die Ermittlungsmaßnahme angeordnet wurde oder hätte angeordnet werden können, verwendet werden (§ 140 Abs 1 Z 4 StPO). Das bedeutet, dass eine Verwendung von Zufallsfunden (also Hinweise auf eine andere/weitere Straftat) nur bei einer vorsätzlich begangenen Straftat mit einer Strafdrohung von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe in Frage kommt.
Neue Perspektive durch einen Strafverteidiger
In der Praxis ist die Überwachung von Nachrichten eine hochkomplexe Maßnahme – sowohl technisch als auch rechtlich. Nicht selten geraten auch Personen in das Visier der Ermittlungsbehörden, die selbst nicht Beschuldigte sind, sondern lediglich mit einer verdächtigen Person kommuniziert haben. Für eine effektive Verteidigung ist es daher zentral, frühzeitig Akteneinsicht zu nehmen, um die Ausmaße der Vorwürfe seriös einschätzen zu können. Auch die Vorbereitung auf eine Beschuldigtenvernehmung oder die Ausarbeitung einer schriftlichen Stellungnahme sollte von einem Rechtsanwalt begleitet werden.
Bei einem Rechtsmittel gegen eine Überwachung von Nachrichten prüft ein spezialisierter Rechtsanwalt die gerichtlich bewilligte Anordnung in Hinblick auf das (Nicht-)Vorliegen der formell- und materiell-rechtlichen Voraussetzungen: Wurde die Maßnahme von einem zuständigen Gericht bewilligt? War die Ermittlungsmaßnahme im konkreten Fall verhältnismäßig? Ist das Einbringen eines Rechtsmittels erfolgsversprechend?
Exkurs: Messenger-Überwachung
Nicht von dieser Maßnahme umfasst ist das sogenannte „Ferninfiltrieren“ von Endgeräten – etwa durch Schadsoftware, die direkt auf dem Gerät des Betroffenen installiert wird, um Kommunikation noch vor der Verschlüsselung abzugreifen. Diese in Deutschland unter den Begriffen Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchungbekannte Maßnahme wurde in Österreich in Form des § 135a StPO bereits 2018 beschlossen („Bundestrojaner“) – vom Verfassungsgerichtshof jedoch vor Inkrafttreten wieder aufgehoben. Grund war unter anderem die massive Streuwirkung solcher Eingriffe und ein nicht ausreichender (Grund-)Rechtsschutz.
Derzeit ist es daher für die Strafverfolgungsbehörden faktisch nicht möglich, verschlüsselte Nachrichten wie WhatsApp-Chats zu überwachen. Erst kürzlich hat der Nationalrat jedoch die sogenannte „Messenger bzw. Gefährder-Überwachung“ beschlossen. Dadurch wird es der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermöglicht, unter engen Voraussetzungen auch verschlüsselte Kommunikationsvorgänge einzusehen.
Die Überwachung von verschlüsselten Nachrichten und Informationen durch Einbringen eines Programms in ein Computersystem (§ 74 Abs 1 Z 8 StGB) eines Betroffenen („Infiltrieren“) ist demnach zulässig, wenn der Einsatz anderer Ermittlungsmaßnahmen aussichtslos wäre und die Überwachung zur Vorbeugung eines verfassungsgefährdenden Angriffs, dessen Verwirklichung mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens zehn Jahre beträgt, bedroht ist, oder nach § 256 StGB (Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs) erforderlich erscheint (§ 11 Abs 1 Z 9 des Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz, SNG).
Die Direktion hat vor der Durchführung einer Überwachung den Rechtsschutzbeauftragten zu befassen und ihm Gelegenheit zur Äußerung binnen drei Tagen zu geben (§ 14 Abs 4 SNG). Anschließend hat sie eine Bewilligung des Bundesverwaltungsgerichtes mittels Antrags einzuholen (§ 15a Abs 1 SNG). Nach Ablauf der Zeit, für die die Ermächtigung erteilt wurde, sind die Betroffenen sowie jene Personen, an die oder von denen Nachrichten übermittelt, gesendet oder empfangen wurden, über Grund, Art und Dauer sowie die Rechtsgrundlage der gesetzten Maßnahme zu informieren (§ 16 Abs 2 SNG).
Durch die (Wieder-)Einführung des Bundestrojaners hat der Gesetzgeber auf die rasante Entwicklung staatsfeindlicher Organisationen in der jüngeren Vergangenheit reagiert. Durch die Möglichkeit, auch verschlüsselte Kommunikationskanäle per Fernzugriff einsehen zu können, wurde zudem dem technischen Fortschritt Rechnung getragen. Ob diese Ermittlungsmaßnahme mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen vereinbar ist und einer Überprüfung des Verfassungsgerichtshofes standhält, ist derzeit (noch) nicht absehbar.